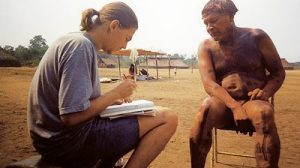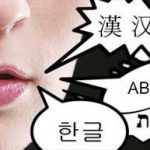Über die Zahl der heute auf dem Erdball gesprochenen Sprachen gibt es weit voneinander abweichende Schätzungen. Nimmt man einen Mittelwert, mögen es etwa 6.000 sein. Doch ihre Zahl verringert sich derzeit schnell. Man vermutet, dass im 21. Jahrhundert, vor allem aufgrund der fortschreitenden Globalisierung, mindestens die Hälfte aller Sprachen weltweit sterben wird. Dem werden nur wenige Neuzugänge gegenüberstehen.
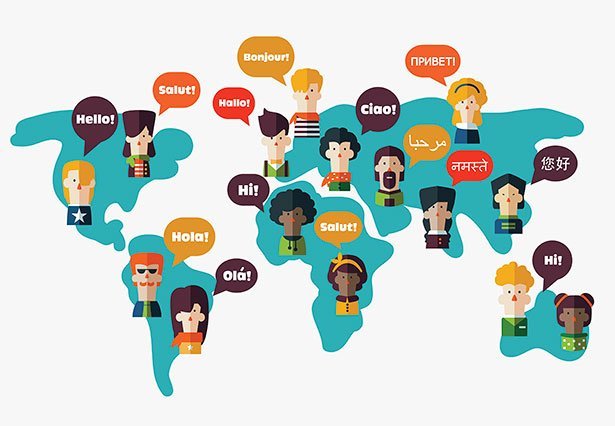
Hinkende Metaphern
Intuitiv meinen wir zu wissen, was der „Tod“ und die „Geburt“ von Sprachen bedeuten – zwei Metaphern, die Sprachen als Organismen begreifen. Allerdings hinkt der Vergleich der sozialen Institution Sprache mit dem Leben etwa eines Menschen. Unter Geburt und Tod verstehen wir scharfe Zäsuren, die die Spanne eines Lebens begrenzen: Lebendig ist das, was geboren und nicht gestorben ist.
Aber wie und wann wird eine Sprache geboren? Schon Wilhelm von Humboldt (1767–1835) stellte fest, „dass man wohl noch keine Sprache jenseits der Grenzlinie vollständigerer grammatischer Gestaltung gefunden, keine in dem flutenden Werden ihrer Formen überrascht hat“. Sprachen gibt es nicht in embryonalen oder kindlichen Zuständen, sie sind immer schon erwachsen, wenn wir auf sie schauen. Deshalb können sie auch nicht eigentlich „geboren“ werden.
Tot, aber noch existierend
Der französische Linguist Claude Hagège sagt zum Bild der toten Sprache: „Zu leben und zu existieren sind zwei verschiedenen Vorstellungen. Eine Sprache, die als tot bezeichnet wird, ist nichts anderes als eine Sprache, die nicht mehr gesprochen wird“, so der Sprachforscher. „Aber wir haben kein Recht, ihren Tod mit dem eines Tieres oder einer Pflanze gleichzusetzen. Hier gelangen die Metaphern an ihre Grenzen. Denn eine tote Sprache existiert weiter.“