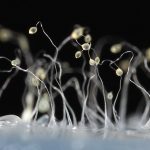In den Wald gehen und Pilze für das Abendessen sammeln ist ein Hobby, das sich seit einigen Jahren zunehmender Beliebtheit erfreut. Nicht nur, weil Pilze lecker, nahrhaft und reich an Eiweiß und Vitaminen sind, sondern auch, weil Pilze sammeln ein naturverbundener Zeitvertreib ist. Doch dabei kommt es immer wieder zu tragischen Verwechslungen von Speisepilzen und Giftpilzen.

Wie viele Giftpilze und Pilzvergiftungen gibt es?
Zu den beliebtesten essbaren Wildpilzen gehören in Deutschland etwa Champignons (Agaricus), Pfifferlinge (Cantharellus), der Austernpilz (Pleurotus ostreatus), der Feldpilz (Agaricus campestris) und einige Russula-Arten (Täublinge). Von unerfahrenen Sammlern werden diese und weitere Speisepilze leider häufig mit verschiedensten der rund 150 heimischen Giftpilze verwechselt. Am häufigsten treten Verwechslungen mit einigen Amanita-Arten wie dem giftigsten aller Pilze auf, dem Grünen Knollenblätterpilz (Amanita phalloides), der schon in geringen Mengen ein tödliches Leberversagen verursacht.
In fünf Prozent aller Fälle geht eine Pilzvergiftung auf den Grünen Knollenblätterpilz zurück, bei tödlichen Fällen sogar zu 80 Prozent, schätzt das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Das Institut verzeichnet jährlich im Schnitt zehn Pilzvergiftungen bei privaten Sammlern und die Giftinformationszentren erhalten jährlich tausende Anfragen zu Giftpilzen und möglichen Vergiftungen. Zwischen 2000 und 2018 wurden über 4.400 Menschen wegen einer Pilzvergiftung in einem deutschen Krankenhaus gegen die Symptome behandelt, wie eine Übersichtsstudie erfasst hat (doi: 10.3238/arztebl.2020.0701). Weltweit sterben jährlich etwa 100 Menschen an einer Vergiftung durch Mykotoxine.

Irreführung durch Aussehen, Geschmack und Geruch
Hauptproblem beim Pilze sammeln ist die Verwechslungsgefahr: „In Deutschland wachsen sehr giftige Pilze, die essbaren Exemplaren ähneln. Das kann für Sammler mit geringer Erfahrung gefährlich sein“, sagt Herbert Desel vom BfR. Jedes optische Pilz-Duo aus harmloser und giftiger Variante hat dabei andere charakteristische Erkennungsmerkmale, die auf Fotos oft nicht alle abgebildet werden können. Das macht allgemeine Faustregeln zur Erkennung und eine eindeutige Unterscheidung schwer.