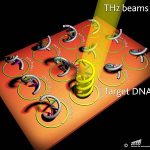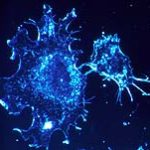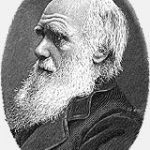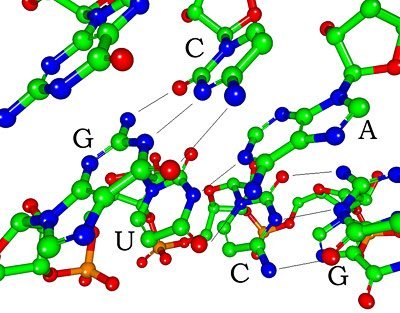Der „Big Bang der Biologie“, wie die britische Zeitschrift „Economist“ die Erkenntnisse im Forschungsfeld der Epigenetik nannte, beginnt zunächst mit einem Flop – noch dazu bei einem Experiment mit Petunien, biederen Balkonpflanzen, bei denen man nicht gerade innovative Forschungsergebnisse erwartet. Im Jahr 1987 wollen die Biologen Joseph Mol aus den Niederlanden und Richard Jorgensen aus den USA Petunien dazu bringen, intensiver zu blühen. Als Methode entscheiden sie sich für die Gentechnik, die gerade ihren Siegeszug beginnt.
Überraschung vom Balkon
Die Biologen schmuggeln zusätzliche Kopien eines blütenfärbenden Petunien-Gens in die Pflanzen, denn bei der künstlichen Zugabe von Farb-Genen, so ihre Annahme, müsste sich der Farbeffekt vervielfachen. Doch zur Überraschung der Wissenschaftler sind die manipulierten, genetisch veränderten Petunien sogar weniger intensiv gefärbt als die Ausgangspflanzen – und manche sogar völlig farblos. Die Forscher nennen diesen Effekt zunächst Co-Suppression: Offenbar werden die ursprünglichen Gene, die die Färbung zu verantworten haben, gemeinsam mit den hineingeschmuggelten Kopien durch die Manipulation unterdrückt.
Anfang der 1990er Jahre dann stoßen die britischen Pflanzengenetiker David Baulcombe und Andrew Hamilton auf einen ähnlichen Effekt. Sie wollen Kartoffelpflanzen gentechnisch so verändern, dass sie gegen bestimmte Viruserkrankungen resistent werden. Sie schleusen ein einzelnes Virus-Gen in die Pflanzen-DNA ein und hoffen, dass dieses die Pflanzenabwehr mobilisiert und damit eine Resistenz gegen das „Mutter-Virus“ des eingeschmuggelten Gens auslöst. Tatsächlich werden die so behandelten Kartoffelpflanzen nicht krank. Die Forscher sind zufrieden. Doch dann schauen sie nach, was das einzelne Virus-Gen in der Kartoffel tatsächlich macht. Die Überraschung: Es wurde korrekt eingebaut, dennoch ist das Virus-Gen aus irgendeinem Grund stumm und wird nicht abgelesen.
C. elegans und die RNA-Interferenz
Zur gleichen Zeit wie Baulcombe und Hamilton forschen zwei Teams um Craig Mello von der Massachusetts University und Andrew Fire vom Carnegie Institute in Baltimore am Fadenwurm Caenorhabditis elegans – einem unscheinbaren Tierchen, nur ein bis zwei Millimeter lang und durchsichtig, dafür aber ein Modellorganismus der Molekularbiologie.