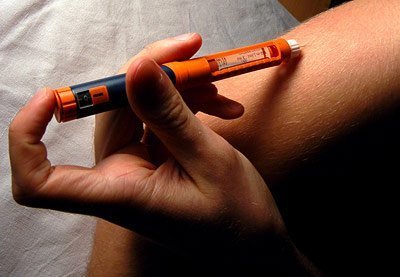Ginkgo-Baum © Kazuo Yamasaki
Manche Baumarten wie der Ginkgo oder die riesigen uralten Mammutbäume im Sequoia Nationalpark in den USA besitzen andere außergewöhnliche „Fähigkeiten“. Sie überstehen sogar heftige Brände oder Stürme ohne größere Schäden. In gewisser Hinsicht sind sie sogar auf Ereignisse wie Feuersbrünste angewiesen. Die Mammutbäume benötigen beispielsweise den besonderen Mineralboden für eine erfolgreiche Keimung, der nach Waldbränden zur Verfügung steht. Die Zapfen öffnen sich deshalb nur bei großer Hitze, um die Samen abzugeben.
Warum manche Tiere oder Pflanzen zu lebenden Fossilien werden, scheint auf diese Art einigermaßen erklärbar, wieso aber haben sie sich in den Jahrmillionen kaum verändert? Diese Frage können Wissenschaftler zumindest für einige der Zeugen aus der Vorzeit heute beantworten.
Professorin Jean Joss vom der Abteilung für Biowissenschaften der Macquarie Universität beschäftigt sich schon seit langem mit den australischen Lungenfischen. Dieses lebende Fossil ist genau in dem kritischen Moment aus dem Aufzug der Evolution ausgestiegen, als vor 400 Millionen Jahren die Reise vom Wasser aufs Land begann.
So ist der Lungenfisch aus Queensland weder ein richtiger Fisch noch ein richtiges Amphibium. Er besitzt beispielsweise sowohl eine Lunge, als auch normale innere Kiemen. Vor allem, wenn er sich viel bewegt oder die Sauerstoffkonzentration im Wasser niedrig ist, greift er dabei auf die Luftatmung zurück. Das Füllen und Leeren des Atmungsorgans wird begleitet von einem Geräusch, das an das Pumpen eines Blasebalgs erinnert. Wie ein Säugetier produziert der Lungenfisch Hormone, um die Fortpflanzung anzukurbeln und seine fußartigen Flossen und die Mahlzähne scheinen wie für ein Leben an Land gemacht.
Jean Joss ist sicher, warum der Lungenfisch genau an dieser Stelle in der Entwicklung stehen geblieben und in einer Sackgasse der Evolution gelandet ist: Das riesige Genom ist schuld. „Der Lungenfisch aus Queensland ist extrem primitiv, er ist ein Schaufenster in die Vergangenheit“, so die Biologin. „Zumindest zur Hälfte dafür verantwortlich ist die Unmenge an DNA in seinen Zellkernen. Er besitzt davon 20 bis 30 mal so viel wie beispielsweise der Mensch. Das verlangsamt die Zellteilung und hat sie in eine Richtung gedrängt, die wir die „K-Strategie“ nennen – sehr langlebig und ziemlich gelassen in Bezug auf die Reproduktion.“
„Schatzkammer für Biologen und Paläontologen
Unmittelbar nachdem ein neues lebendes Fossil entdeckt worden ist, setzt unter den Wissenschaftlern meist ein unglaublicher Rummel um die Tiere ein. Egal ob beim Quastenflosser, Pfeilschwanzkrebs oder Ginkgo, steigert sich das Interesse der Forscher manchmal geradezu zu einer Art Manie. Denn lebende Fossilien sind für Wissenschaftler nicht nur aufgrund irgendwelcher Kuriositäten oder besonderen Fähigkeiten interessant, sie haben auch eine praktische Bedeutung als Informationslieferant über die Urzeit.
Die Forscher wollen beispielsweise wissen, ob die Evolution der Arten in Sprüngen oder gleichmäßig verlief oder wie Urfische früher aussahen und welches Verhalten sie zeigten Lebende Fossilien liefern dabei oftmals Hinweise oder Indizien, um auf solche Fragen die richtige Antwort zu finden.
Ein Beispiel: Von Tieren und Pflanzen, die im Gestein oder anderswo als Fossilien die Zeit überdauert haben, sind in der Regel nur die harten Bestandteile wie Knochen oder Schalen übrig geblieben. Von den Weichteilen der uralten, längst ausgestorbenen Arten fehlt meist jede Spur und die Wissenschaftler müssen sie daher anhand von Indizien, manchmal auch nur vagen Vermutungen, mühsam rekonstruieren. Haben sie jedoch lebende Fossilien dieser Arten als Studienobjekte parat, ist das Dilemma schnell beseitigt.
Vom heutigen Aussehen und Verhalten dieser Tiere und Pflanzen können die Paläontologen und Evolutionsforscher vergleichsweise sichere Rückschlüsse auf die Situation vor Millionen von Jahren ziehen und so das Wissen über den Stammbaum des Lebens und die verschiedenen Erdzeitalter wie Jura oder Kreide erweitern.
Stand: 10.12.2004
10. Dezember 2004