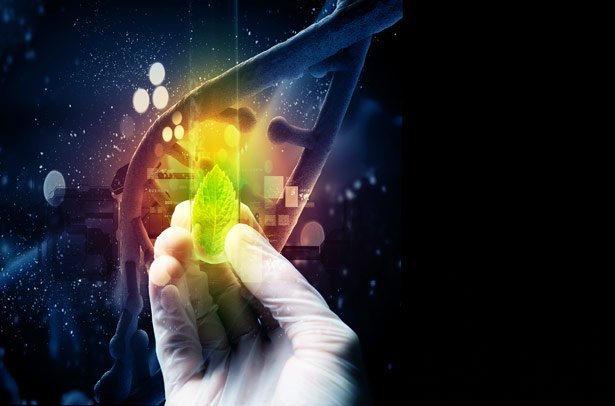Als der Mensch vor 10.000 Jahren die Landwirtschaft erfand, begann er nicht nur, Pflanzen anzubauen und Tiere zu halten – sondern diese auch gezielt zu züchten. So entstanden im Laufe der Zeit auf möglichst viel Fleisch- oder Milchproduktion ausgelegte Tierarten und Kulturpflanzen mit mehr und größeren Früchten. Als Nebenwirkung führte dieser Zuchtprozess jedoch zu einer geringeren genetischen Vielfalt und zum Verlust zahlreicher nützlicher Eigenschaften.

Viele moderne Kulturpflanzen sind beispielsweise weniger widerstandsfähig als ihre wilden Vorfahren. Sie sind anfällig für Krankheiten, reagieren empfindlich auf Schädlingsbefall und können nicht gut mit Trockenheit oder Überschwemmungen umgehen. Genau solche Merkmale werden angesichts des Klimawandels und der wachsenden Weltbevölkerung zunehmend zum Problem – durch traditionelle Zucht sind sie aber nur schwer oder gar nicht auszumerzen.
Umstrittener Genmais
Eine Lösung soll die Grüne Gentechnik sein. Dabei werden Pflanzen mithilfe gentechnischer Verfahren mit gewünschten Eigenschaften ausgestattet. Oft geschieht dies, indem ein oder mehrere Gene einer anderen Art in das Erbgut der Pflanze eingeschleust werden. Derart veränderte Pflanzen wurden erstmals 1995 in Kanada kommerziell angepflanzt: in Form von Genraps. Im Jahr darauf folgte bereits die wirtschaftliche Nutzung von transgenem Soja in den USA. Inzwischen werden transgene Kulturpflanzen weltweit auf einer Fläche von knapp 190 Millionen Hektar angebaut.
In der Europäischen Union ist derzeit allerdings nur eine gentechnisch veränderte Pflanze überhaupt zum Anbau zugelassen: Mais der Sorte MON810. Er trägt ein Gen des Bodenbakteriums Bacillus thuringiensis in sich und ist dadurch in der Lage, einen insektiziden Stoff zu produzieren. Dank dieser chemischen Waffe kann er Schädlinge wie den Maiszünsler abtöten, bevor Fraßschäden entstehen.