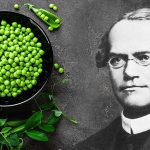„Ich glaube, nur wenige Entdeckungen waren von so perfekter Schönheit,“ so beschrieb James Watson vor rund 70 Jahren ein mehr als zwei Meter hohes Metallgerüst aus Pappe und Drähten, das einer schraubenförmig gewundenen Strickleiter glich – die Doppelhelix.
Auf einer knappen Seite, illustriert lediglich durch eine einzige Abbildung, veröffentlichte er zusammen mit Francis Crick am 25. April 1953 in der Zeitschrift „Nature“ den Modellvorschlag für die räumliche Struktur unseres Erbguts, der Desoxyribonukleinsäure (DNA). Es schien, als wären sich die beiden Forscher der zukunftsweisenden Bedeutung ihres Modells ziemlich sicher, denn schon im zweiten Satz wiesen sie auf „die neuartigen Eigenschaften von beträchtlichem biologischem Interesse“ hin.

Keine Lust auf Chemie
Doch zugetraut hätte den beiden „wissenschaftlichen Clowns“, wie der Biochemiker Erwin Chargaff sie damals bezeichnete, eine solche Entdeckung zunächst niemand. Hochbegabt, schrieb sich James Watson schon im Alter von 15 Jahren an der Universität von Chicago zum Biologiestudium ein. Sein Interesse galt damals vor allem der Vogelwelt und so drückte er sich erfolgreich um jeden Chemie- und Physikkurs.
Daher war es wenig verwunderlich, dass seine Kenntnisse auf diesem Gebiet eher bescheiden ausfielen, als der damals erst 23-jährige Zoologe im Herbst 1951 an das Cavendish Laboratory ins britische Cambridge kam. Dort traf er auf den 13 Jahre älteren britischen Physiker Francis Crick, der seine Kollegen vor allem durch sein dröhnendes Lachen nervte. Der Institutsleiter Sir Lawrence Bragg fasste Cricks bisheriges Forscherdasein damals mit den Worten zusammen, dass „Francis nun schon ununterbrochen geredet habe, und so gut wie nichts von entscheidendem Wert dabei herausgekommen sei.“