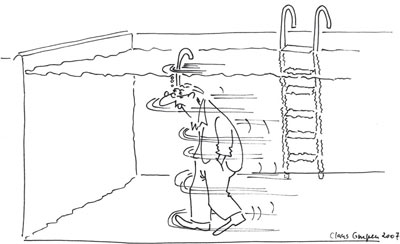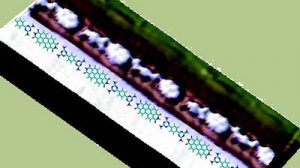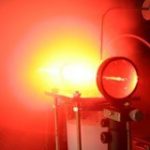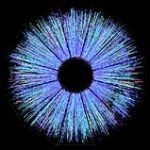Anschaulich lässt sich der Higgs-Mechanismus durch folgende Analogie beschreiben: Betrachten wir die Bewegungen eines Menschen, der der Tristesse des deutschen Winters entfliehend, seine Runden durch eine Poollandschaft in Südspanien dreht – korrekter gehen wir davon aus, dass der Badegast nicht schwimmt sondern sich laufend über den Beckenboden bewegt. Sehen können wir, dass sich der Urlauber im Wasser vergleichsweise nur langsamer fortbewegen kann, als der Bademeister, der am Beckenrand entlang spaziert. Würde man diese triviale Beobachtung auf ihre Ursachen zurückführen wollen, so würden sich zwei Erklärungsmöglichkeiten anbieten.
Mit oder ohne Wasser
Erstens: man vernachlässigt für die Erklärung die Existenz des Wassers. Warum bewegt sich der Winterflüchtling im Pool bei gleicher Muskelkraft dann auf einmal langsamer fort als der Aufseher am Beckenrand? Einzige Erklärung: sein Gewicht – der Physiker würde präziser sagen: seine Masse – muss plötzlich zugenommen haben, so dass die Muskelkraft den Körper nur schleppender nach vorne bringen kann.
Zweite Erklärungsmöglichkeit: man bezieht das Wasser in die Erklärung mit ein. Dann lässt sich plausibel behaupten, dass der Urlauber gegen den Widerstand des Wassers anlaufen muss; das Wasser ‚bremst’ den Urlauber aus, so dass er bei derselben Kraftanstrengung nur langsamer vorankommt. Was wir bei der ersten Begründung noch Masse genannt haben, würden wir jetzt ‚Reibungswiderstand’ nennen.
Bezogen auf die Massenerzeugung der Elementarteilchen ähnelt diese kleine Episode aus den warmen Gefilden des sonnigen Südens dem Bild der Teilchenphysiker von der Natur. Der Higgs-Mechanismus behauptet die Existenz eines omnipräsenten Hintergrundfeldes. Wie das Wasser den Pool, füllt demnach das Higgs-Feld das Weltall homogen und isotrop aus.