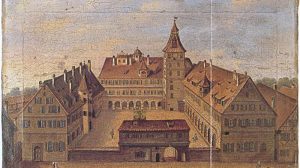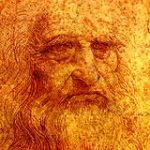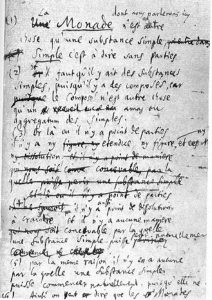Leibniz neuer Dienstherr, Herzog Ernst August von Hannover, verlangt, dass der Gelehrte statt der Forschung seinen Aufgaben als Hofrat nachkommt und beauftragt ihn 1685 mit der Niederschreibung der Welfengeschichte. Die Welfen sind ein altes Adelsgeschlecht, zu denen auch Herzog Ernst August gehört und die lange Zeit viel Einfluss in Hannover besitzen werden.
So gründlich und stets auf den Ursprung der Dinge bedacht wie es Leibniz ist, beginnt er diese Geschichte mit einer Abhandlung über die Entstehung der Welt. So ist es auch nicht verwunderlich, dass er die Historie niemals fertigstellen, sondern „nur“ bis in das Jahr 1005 nach Christus vordringen wird. Das Projekt wird ihn zudem bis an sein Lebensende begleiten.
Allerdings veröffentlicht Leibniz in den Jahren von 1701 bis 1711 seine Zwischenergebnisse und eine umfangreiche Quellensammlung, damit das große Werk auch nach seinem Tod nicht verloren ginge. Insbesondere diesem Fokus auf die Wichtigkeit der Quellen und den Umgang mit ihnen verdankt Leibniz heute den Titel als Stammvater der wissenschaftlichen Geschichtsschreibung. Der Gelehrte ist der Meinung, dass nur der richtige Umgang mit Quellen eine geschichtliche Wahrheitsfindung ermöglicht und dass nur eine Publikation der Quellen wissenschaftlich fundierte und überprüfbare Geschichtsschreibung bedingt.

Auf seinen Recherchereisen für das große Welfen Geschichtswerk gelangt er auch nach Rom, wo ihm die Leitung der Vatikanbibliothek angeboten wird. Da er Protestant ist, lehnt er diese zwar ab, übernimmt aber noch im gleichen Jahr die Leitung der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Hier geht er mit der Konzipierung des ersten Ordnungssystems für Bücher in die Geschichte ein. Erstmals sortiert er Werke nach Genre, Fachbereichen und nach Alphabet. So können die einzelnen Werke nun schnell und gezielt gefunden werden.