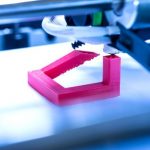Ob schwer heilende Wunden, starke Blutungen oder chirurgische Nähte an inneren Organen: Wenn es um den schnellen und sicheren Verschluss solcher offenen Verletzungen geht, gewinnen Hydrogele in der Medizin immer mehr an Bedeutung. Denn sie sind flexibel und anpassungsfähig genug, um Wunden dicht abzuschließen. Zudem vernetzen sich diese Materialien so eng mit dem Gewebe, dass sie selbst bei mechanischer Belastung sicher haften.

Halt selbst bei mechanischer Belastung
Eine Anwendung der Hydrogele sind Wunden und Nähte an sich bewegenden Organen wie der Lunge oder dem Herzen. Diese dehnen sich regelmäßig aus oder kontrahieren und entspannen. Nähte an diesen Organen sind daher starken mechanischen Belastungen ausgesetzt. In der Chirurgie werden daher zusätzlich zu herkömmlichen Fäden oder Klammern auch Gewebekleber eingesetzt – und meist bestehen sie aus einem Hydrogel.
Einer dieser Nahtkleber beruht auf einem körpereigenen Protein, dem Elastin. Das Molekül gehört zu den sogenannten Strukturproteinen und sorgt unter anderem für die Dehnungsfähigkeit unserer Haut, der Lunge und großer Blutgefäße wie der Aorta. Für den Kleber wird Tropoelastin, ein Vorläufer von Elastin, mit einem Molekül namens Methacrylsäureanhydrid kombiniert.
Wird diese Kombination auf eine Naht aufgetragen und dann mit UV-Licht bestrahlt, polymerisiert die Mischung zu einem hochelastischen, fest mit dem Gewebe verbundenen Hydrogel. In ersten Tests unter anderem an Schweinen hielt dieser Kleber bei schweren Lungenschäden besser als zuvor gängige Versiegelungen. Das gehärtete Hydrogel blieb solange auf der Wunde kleben, bis der Heilungsprozess abgeschlossen war. Anschließend zerfiel der Stoff langsam – ohne giftige Rückstände zu hinterlassen.