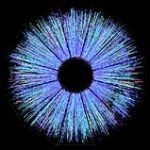Spätestens als Albert Einstein offene Aufrufe zum Mord an seiner Person in der Zeitung las, muss ihm klar gewesen sein, dass er Deutschland den Rücken kehren würde. Die „Staatsbürger Zeitung“ verkündete damals: „Zur Liga gehören u. a. Professor Einstein … Wir würden jeden Deutschen, der diese Schufte niederschießt, für einen Wohltäter des deutschen Volkes halten.“
Im antisemitisch geprägten Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg war es für Einstein sicher nicht förderlich, dass er Jude war. Dazu kam dann noch die Tatsache, dass er – im Gegensatz zu den meisten anderen Wissenschaftlern seiner Zeit – ein starkes politisches Engagement zeigte. Sein ganzes Leben lang war er „hin und her gerissen zwischen Politik und Gleichungen“.
Zu naiv für die Politik
Die Politik beeinflusste auch Einsteins Verhältnis zum Judentum. Hatte er sich noch mit 16 Jahren als konfessionslos bezeichnet und von Gott oft als dem „Alten“ gesprochen, identifizierte er sich während seiner Zeit in Berlin mehr und mehr mit dem Judentum. Vor allem das Selbstbewusstsein und eine Solidarität unter Juden waren ihm wichtig. Diese Ansichten machten die zionistische Bewegung auf Einstein aufmerksam. Diese seit 1897 bestehende Bewegung verfolgte das Ziel der Gründung eines unabhängigen jüdischen Staates. Einsteins großes Engagement führte 1952 schließlich dazu, dass ihm die Präsidentschaft Israels angeboten wurde. Eine Ehre, die der Physiker mit der Begründung ablehnte, er sei zu naiv für die Politik.
Davon ahnte Einstein natürlich noch nichts, als zu seinen Berliner Zeiten die „abscheuliche Relativitätslehre“ als „schreckliche Missgeburt“ und „verarmtes Kunstgebilde“ abgetan wurde. Es erschien sogar ein Buch mit dem Titel „100 Autoren gegen Einstein“. Ein Mann, der der Anstiftung zum Mord an Einstein angeklagt wurde, kam mit einer Geldstrafe davon. Andererseits galt er mit steigender Popularität zunehmend als „Kulturfaktor ersten Ranges“, der Deutschland im Ausland repräsentieren und sich herum zeigen lassen musste „wie ein prämierter Ochse“.