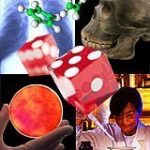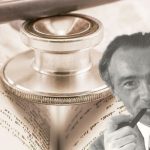Früher wurden spannende (Neben-)Wirkungen bekannter Medikamente häufig zufällig beobachtet. „Die erfolgreichsten Beispiele umfunktionierter Wirkstoffe hatten wenig mit einem systematischen Ansatz zu tun“, erklären Sudeep Pushpakom von der University of Liverpool und seine Kollegen in einem Fachartikel in „Nature Reviews Drug Discovery“. Doch heute wollen immer weniger Wissenschaftler diese Sache dem Zufall überlassen: Sie suchen strategisch nach neuen Anwendungsgebieten für alte Mittel.

Aber wie? Prinzipiell gibt es mehrere Möglichkeiten, nach bisher unbekannten Wirkungen bereits zugelassener oder in klinischen Studien zumindest als sicher erwiesener Arzneistoffe zu fahnden. Einer der gängigen Ansätze ist die computergestützte Datenauswertung: Dabei werden riesige Datensätze durchforstet und analysiert.
Suche in Datensätzen
Dies können zum Beispiel genetische Informationen sein. Im Rahmen genomweiter Assoziationsstudien lassen sich Zusammenhänge zwischen bestimmten Krankheiten und genetischen Variationen herstellen. Dadurch ergeben sich neue Einblicke in die Biologie dieser Leiden und möglicherweise neue Angriffspunkte für Therapien. Kennen Forscher nun bereits Medikamente, die auf diese sogenannten Targets wirken, haben sie einen Kandidaten zum Umfunktionieren.
Auch Daten aus klinischen Studien sind mitunter aufschlussreich. Womöglich finden sich bei der Durchsicht der Untersuchungsprotokolle bisher unbeachtete Hinweise auf interessante Wirkungen – und damit mögliche neue Anwendungsgebiete für ein therapeutisches Mittel.