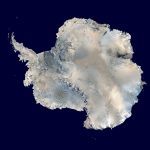Bei der folgenden österreichischen Nordpolar-Expedition von 1872 bis 1874 unter Julius Payer und Karl Weyprecht, die die gänzlich unbekannten Regionen nördlich von Nowaja Semlja erforschen und vielleicht sogar die Nordostpassage finden soll, wird der Traum August Petermanns vom offenen Nordpolarmeer endgültig „zu Grabe getragen“.
Auf 79° 7′ Nord und 59° 5′ Ost finden die Arktisforscher auf dem Schiff Admiral Tegetthoff nach einer Überwinterung im Eis am 31. August 1873 immerhin Franz-Josef-Land. Auf der großen Schlittenreise zur Erkundung des Geländes im nächsten Jahr dringen sie dann unter Aufbietung der letzten Kräfte zu Fuß weit nach Norden bis auf 82° vor – einen großen Ozean mit gemäßigtem Wasser können sie allerdings nirgends entdecken. Der Kommentar Payers in Richtung Petermann nach der Rückkehr nach Bremerhaven am 3. September 1874 spricht Bände: „Seids froh, daß jemand ein offenes Polarmeer zu erreichen strebt, denn thäte es niemand, dann gäbe es gar keine Nordpolexpeditionen.“
Expeditionen reichen nicht
Obwohl der Nordpol 1875 noch immer nicht erreicht ist, erkennen Wissenschaftler wie Georg Neumayer schon bald, dass die Erforschung der Arktis mit Expeditionen allein nicht zu machen ist. Ein Netz von ständigen Messstationen sei nötig – so auch die Forderung von Karl Weyprecht -, um „systematische wissenschaftliche Untersuchungen auf dem Gebiet der Meteorologie und anderen Gebieten der Geophysik durchzuführen.“
Schon im Internationalen Polarjahr 1882/83 zollt die neu gegründete Polarkommission dieser Erkenntnis und Entwicklung Tribut. Allein in der Arktis werden unter Beteiligung von Ländern wie Deutschland, Russland oder Norwegen 13 feste Langzeitmessstationen eingerichtet, die kontinuierlich Daten erfassen und wertvolle Erkenntnisse liefern.