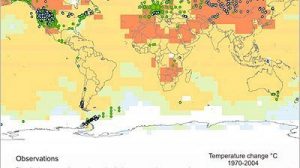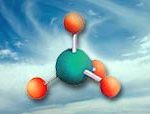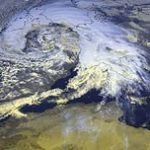Auf der Karibikinsel Barbados installieren Max-Planck-Forscher gemeinsam mit Forschern des Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology in Barbados und der Uni in Miami gerade Fernerkundungsinstrumente. Es handelt sich dabei um Radargeräte und um eine Art Lichtradar, der mit Laserstrahlen arbeitet. Sie sollen die vom offenen Ozeankommenden Wolken ins Visier nehmen.
„Die Daten werden uns helfen, die Beziehungen zwischen der Wolkenbedeckung, dem Niederschlag, Aerosolen und den Eigenschaften der die Wolken umgebenden Luft zu erklären“, sagt Bjorn Stevens vom Max-Planck-Institut für Meteorologie.

Satelliten als Helfer
Der Wolkenforscher sieht nicht nur dieser Messkampagne sehr optimistisch entgegen, sondern der Zukunft der Wolkenforschung insgesamt. „Wir werden in den nächsten 25 Jahren ein Vielfaches dessen über Wolken lernen, was wir in den letzten 25 Jahren gelernt haben“, sagt er sichtlich erfreut. Im letzten Vierteljahrhundert seien die Beobachtungstechniken entwickelt worden. „Jetzt benutzen wir sie.“
Satelliten seien inzwischen in der Lage, mithilfe von Radar und Laserstrahlen dreidimensionale Bilder von Wolken und ihrem Inneren anzufertigen. Außerdem erleichtere es die wachsende Rechenkraft von Computern immer weiter, physikalische Prozesse auf immer mehr Größenskalen gleichzeitig zu simulieren − freilich erst, nachdem man die entsprechenden Prozesse verstanden habe.