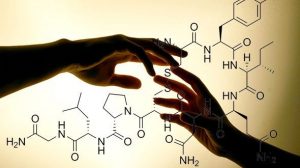Kleinkindern ist es noch weitgehend gleichgültig, ob sie mit einem Mädchen oder einem Jungen spielen. Das ändert sich im Kindergartenalter: Jetzt wird es immer wichtiger, sich selbst eindeutig einem der beiden Geschlechter zuzuordnen.

Haare, Kleidung, Spielzeug
Äußere Merkmale werden nun auch für die Kinder selbst immer wichtiger: Wer lange Haare hat und Kleider oder Röcke trägt, ist ein Mädchen; wer kurze Haare hat und immer nur Hosen trägt, ist ein Junge. Während die Jungen zumeist eher motorisch aktiv und umtriebig sind, spielen die Mädchen lieber stationär. Mädchen und Jungen wünschen sich unterschiedliche Spielzeuge, und die Wirtschaft kommt diesem Wunsch gerne entgegen, indem sie mit ihren Produkten gezielt die eine oder andere Geschlechtsgruppe anspricht.
Geschlechtstypische Vorlieben sind damit sowohl Teil unserer Identitätsbildung als auch Folge gesellschaftlicher Einflüsse. Wie unsere Studien zum Temperament im Säuglingsalter nahelegen, hat ein geschlechtsrollenspezifisches Verhalten biologische Wurzeln – aber es wird durch Beobachtungslernen und Imitation zusätzlich verstärkt.
Eine kleine Anekdote mag dies verdeutlichen: Eine Fünfjährige traf von sich aus die Unterscheidung zwischen „mamarieren“ – beispielsweise Hosen flicken – und „paparieren“ – beispielsweise den Computer wieder in Gang bringen – und markierte damit den geschlechtsneutralen Ausdruck „reparieren“ so, wie sie es aus der Beobachtung gelernt hatte.

Der Einfluss der Eltern
Ein geschlechtsrollenkonformes Verhalten des Kindes wird von Bezugspersonen noch zusätzlich verstärkt. Egal, ob es um den Ausdruck von Gefühlen, um konkrete Handlungen oder um das Interesse an bestimmten Dingen geht – ständig kommentieren Erwachsene das Verhalten der Kinder zudem in bewertender Weise. Viele Eltern werden auch heute noch wenig davon begeistert sein, wenn ihr Sohn unbedingt Ballettunterricht nehmen will.
Durch die Wahl von Hobbys und bestimmten Aktivitäten wird indirekt der Freundeskreis bestimmt, und so tragen sukzessiv mehr und mehr unterschiedliche Faktoren dazu bei, dass sich Rollenbilder verfestigen. Deshalb mag es kaum mehr überraschen, dass sich Mädchen- und Jungengruppen während der Grundschulzeit immer stärker voneinander separieren.
Sabina Pauen & Miriam Schneider, Universität Heidelberg/ Ruperto Carola
Stand: 25.08.2017