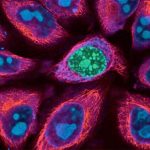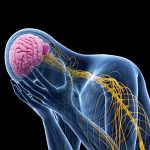Trotz des inzwischen tiefen Verständnisses der Krankheitsbilder und ihrer Verbreitung in der Bevölkerung, wird die Diagnose Rheuma in zahlreichen Fällen immer noch zu spät gestellt. Bei Frauen dauert es dabei deutlich länger, bis sie die richtige Diagnose erhalten. Denn bei ihnen ist die Erkrankung zwar häufiger, verläuft aber oft milder als bei Männern, so dass sich eindeutige Blutmarker, Gelenk- und Organschäden erst später zeigen, wie eine Analyse ergab (doi: doi.org/10.1007/s00108-023-01484-3). „Hinzu kommt, dass Frauen ein vielfältigeres Bild an Symptomen zeigen, was eine eindeutige Diagnose zusätzlich erschweren kann“, sagt Uta Kiltz vom Rheumazentrum Ruhrgebiet.
Warum fällt die Diagnose so schwer?
Für Allgemeinmediziner sind die Symptome in frühen Phasen zudem teilweise nur schwer zu erkennen oder von anderen, orthopädischen Krankheiten zu unterscheiden. Auf Röntgen- oder MRT-Bildern sind die Gelenkschäden an Knochen oder Knorpel mitunter (noch) nicht gut erkennbar, gleiches gilt für Ultraschallaufnahmen und die entzündete Gelenkinnenhaut.

Zwar gibt es Marker im Blut, die auf eine Entzündung hinweisen, zum Beispiel ein erhöhter Wert des C-reaktiven Proteins, der sogenannte Rheumafaktor und bestimmte Antikörper. Diese zeigen jedoch nur einen Teil der rheumatoiden Arthritis-Fälle an, bei weitem nicht alle rheumatischen Erkrankungen. Zusätzlich erschwert wird die genaue Diagnose bei älteren Menschen, wenn sie unter zwei Rheuma-Formen gleichzeitig leiden, etwa Arthrose und rheumatoider Arthritis.
„Rheumatische Erkrankungen sind schwer zu diagnostizieren und bedeuten für viele Betroffene eine Odyssee von Arzt zu Arzt. Oft vergehen Jahre bis zur Diagnose“, erklärt die Deutsche Rheumaliga. Viele Betroffene leiden daher unnötig und entwickeln irreparable Schäden an ihren Gelenken, weil sie erst nach mehreren Monaten oder Jahren an einen Facharzt überwiesen werden. Hinzu kommen dann oft lange Wartezeiten für Behandlungstermine in der Rheumatologie.