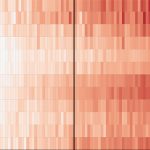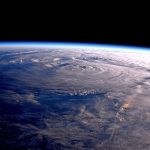Ein weiterer großer Streitpunkt auf der Weltklimakonferenz von Glasgow werden die Finanzen sein. Weil ärmere Länder einen erheblich geringeren Anteil an den anthropogenen Emissionen haben, aber gleichzeitig zu den Hauptleidtragenden des Klimawandels gehören, sollen sie sowohl bei Klimaschutzmaßnahmen als auch bei Anpassungen an die Klimafolgen unterstützt werden.

Bereits im Jahr 2010 hatten sich die OECD-Staaten darauf geeinigt, aus privaten und staatlichen Geldern jährlich 100 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen in ärmeren Ländern bereitzustellen. Ab 2020 soll, so der damalige Beschluss, diese Summe erreicht sein. Bei der Pariser Klimakonferenz 2015 wurde dies noch einmal bekräftigt und man beschloss, die pro Jahr bereitgestellte Summe ab 2025 weiter aufzustocken.
Undurchsichtige Abrechnungen
Das Problem jedoch: Die Gelder werden nicht in einen zentralen Fond eingezahlt, sondern die Industrieländer haben sich verpflichtet, jährlich einen Teil ihres Budgets in Form von finanziellen oder technischen Hilfen in Klimaschutzmaßnahmen in den Entwicklungsländern zu investieren. Für diese meist bilateral geleisteten Hilfen gibt es aber keine einheitlichen Abrechnungsmodalitäten, so dass die tatsächlich geleisteten finanziellen Hilfen nur schwer erfassbar und vergleichbar sind.
Hinzu kommen Streitigkeiten darüber, was überhaupt dafür angerechnet werden darf. “ Ein Vierteljahrhundert nach dem Beginn der Klimaschutzverhandlungen fehlt uns noch immer ein adäquates System, um die internationale Klimaschutzfinanzierung zu definieren, zu kategorisieren und nachzuverfolgen“, konstatierten Romain Weikmans von der Freien Universität Brüssel und seine Kollegen bereits 2019 im Fachmagazin „Climate and Development“.