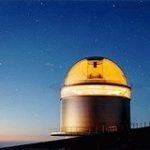Ob ein hell leuchtender Stern entsteht oder aber „nur“ ein Brauner Zwerg, ein „verhinderter“ Stern, entscheidet sich schon bei ihrer Geburt .
Sterne bilden sich nicht einzeln irgendwo im leeren Raum, sondern in gewaltigen Wolken aus Gas und Staub. Solche Sternenwiegen finden sich beispielsweise im bekannten Orionnebel oder auch in den Staubsäulen des Pferdekopfnebels. Durch die eigene Schwerkraft, manchmal auch durch Druckwellen von außen, fallen Bereiche dieser Wolken in sich zusammen und werden immer heißer und dichter. Dieser Kollaps gibt zunächst noch Energie in Form von Strahlung ab. Durch ihre eigene Masse komprimiert, bilden sich dann jedoch Klumpen von Wasserstoffgas und Staub, die so dicht sind, dass die Strahlung nicht mehr entweichen kann. Das Innere dieser Klumpen heizt sich immer stärker auf, die Atome rücken näher und näher zusammen.
Fusion: der Sternenmotor startet
Dann ist es plötzlich soweit: Die Temperatur im Klumpeninneren steigt auf mehr als fünf Millionen Kelvin. In diesem Höllenofen aus Hitze und Druck muss selbst die starke Abstoßung zwischen den Atomkernen klein beigeben: Sie beginnen zu verschmelzen und setzen dabei gewaltige Menge an Energie frei. Die Kernfusion ist gezündet – ein Stern ist geboren.
Die Fusion von Wasserstoffkernen zu Helium bildet den Brennstoff, der den neu entstandenen Himmelskörper für Milliarden Jahre am Leuchten halten wird. Im Kern unserer Sonne wandelt dieser stellare Fusionsreaktor in jeder Sekunde die gewaltige Menge von 564 Millionen Tonnen Wasserstoff zu Helium um. Gut vier Millionen Tonnen pro Sekunde werden dabei zu Strahlung und machen unseren Zentralstern zu dem gelb leuchtenden Zwergstern, der er noch einige Milliarden Jahre bleiben wird.