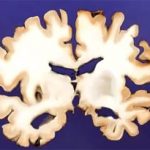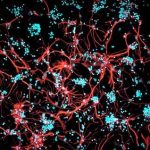Vor allem zur Verarbeitung von traumatischen Erlebnissen werden in der Psychotherapie inzwischen Ansätze zum aktiven Vergessen erprobt. Aber warum kann das helfen? Und können wir wirklich aus schierer Willenskraft vergessen?
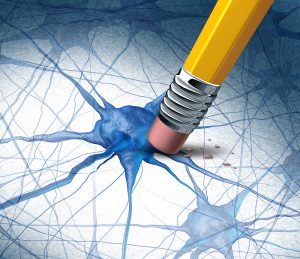
Verstauen anstatt Verschwinden lassen
„Das deutsche Wort ‚vergessen‘ beruht auf dem Stamm ‚gessen‘ und drückte ursprünglich eine Bewegung in Richtung des Sprechers aus; er ‚bekommt‘ also etwas. Durch die Vorsilbe ‚ver‘ wird es ins Gegenteil verwandelt. Damit ist Vergessen vom Wortstamm her ein aktiver Prozess“, sagt Neurobiologe Martin Korte gegenüber „Spektrum der Wissenschaft“. Doch nicht nur wörtlich gesprochen ist das Vergessen eine aktive Handlung, anscheinend können wir den Vergessens-Prozess tatsächlich bewusst steuern.
Dabei ist das Vergessen aber kein Verschwinden der Erinnerungen, sondern eher ein Verstauen in der hintersten Gedanken-Schublade, an die man nur noch schwer herankommt. Was damit auf neurobiologischer Ebene gemeint ist, erklärt der Neurowissenschaftler Henning Beck: „Damit wir etwas organisch vergessen, müssen sich die Nervennetzwerke so verändern, dass ein Aktivitätsmuster, also die Erinnerung, nicht mehr ausgelöst werden kann. Mitunter bauen sich Kontaktstellen so um, dass die Fähigkeit verloren geht, ein Gedankenmuster hervorzurufen“.
Neue Denkmuster entwickeln
Aber wie funktioniert das in der Praxis? Wenn eine Person beispielsweise auf dem Weg zur Arbeit überfallen wurde und dabei körperlich unversehrt bleibt, muss sie trotzdem mit einer verstärkten Angst vor einem erneuten Überfall leben. Sie geht vielleicht einen alternativen Weg zur Arbeit, bleibt irgendwann lieber im Home-Office und traut sich bald im schlimmsten Fall gar nicht mehr raus.