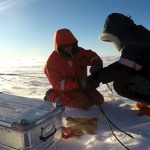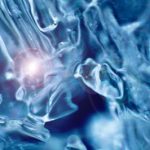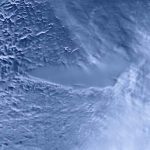Die intensive internationale Zusammenarbeit im Rahmen des geophyikalischen Jahrs 1957-58 trug nicht nur wissenschaftliche Früchte – auch in der Politik wirkten sich die Erfahrungen der gemeinsamen Forschungsprojekte und die neugewonnenen Erkenntnisse aus: Während bisher die in der Polarforschung aktivsten Staaten auch immer dafür sorgten, neuen territoriale Claims in der Antarktis abzustecken, sollte sich dies nun ändern.
International aufgeteilt
Schon 1948 hatten die USA vorgeschlagen, die Antarktis entweder den Vereinten Nationen oder einer aus acht Staaten bestehenden Organisation zu unterstellen. Zu diesem Zeitpunkt existierten bereits Claims von Neuseeland, Australien, Frankreich, Norwegen, Großbritannien, Chile und Argentinien und weitere Ansprüche waren bereits absehbar. Um zu verhindern, dass die Antarktis, ähnlich wie Afrika oder Südamerika bei ihrer Kolonialisierung im 18. Jahrhundert, in ein Mosaik aus territorialen Ansprüchen und Kolonien zerfiel, wurden die Wissenschaftler aktiv.
Auf ihre Anregung hin entstand 1959 ein Internationales wissenschaftliches Komitee für Antarktisforaschung (SCAR). In dieser regierungsunabhängigen Organisation sollten Wissenschaftler aus mehr als zwanzig Ländern in zehn Arbeitsgruppen – entsprechend der unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen – die Polarforschung auf internationaler Eben organisieren und koordinieren.
Vertraglich gesichert

Dieser Initiative folgte noch im gleichen Jahr ein Meilenstein der internationalen Politik und Wissenschaft: Am 1. Dezember 1959 unterzeichneten Regierungsvertreter von zwölf Nationen den Antarktisvertrag. Er sollte sicherstellen, dass die Antarktis auch in Zukunft für die wissenschaftlichen Aktivitäten aller Nationen offen bleiben und friedliche Forschung auf dem siebten Kontinent ungehindert möglich sein würde.