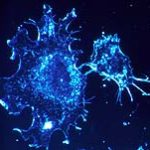„Spenden Sie Blut – Ihre Spende kann Leben retten!“ So oder ähnlich lauten alljährlich die Aufrufe kurz vor der Urlaubszeit, mit denen Blutspendedienste werben. Denn vor allem in den Sommermonaten kommt es immer wieder zu Engpässen, weil nicht genügend Blutkonserven zur Verfügung stehen. Zum einen passieren durch den Reiseverkehr statistisch mehr Unfälle, so dass einfach mehr Blut benötigt wird. Zum anderen fallen regelmäßige Spender aus, weil sie im Urlaub sind.
Doch es gibt noch weitere Ursachen für die allgemein rückläufige Anzahl von Blutspendern, wie zum Beispiel das steigende Durchschnittsalter der Bevölkerung. Mit den fortschreitenden Möglichkeiten in der Medizin unterziehen sich viele ältere Menschen operativen Eingriffen, wie zum Beispiel einer Hüftoperation. Dies erfordert die vermehrte Bereitstellung von Blutkonserven. Allerdings halten Blutkonserven nur maximal 40 bis 42 Tage. Auch die steigende Anzahl von Menschen, die mit Krankheitserregern infiziert sind, wie beispielsweise HIV oder Hepatitis, macht immer mehr Spenderblut von vornherein unbrauchbar. Seit bekannt wurde, dass Krankheiten wie AIDS und Hepatitis durch Bluttransfusionen übertragen werden können, reagieren viele Menschen mit Skepsis, wenn es darum geht, menschliches Blut zu spenden oder anzunehmen.
Auf der Suche nach dem geeigneten Ersatz
Daher suchen Mediziner fieberhaft nach Ersatzmitteln. Künstliches Blut wäre die beste Alternative. Doch nach jahrzehntelangen Experimenten mussten die Wissenschaftler inzwischen einsehen, dass es trotz zahlreicher Bemühungen unmöglich ist, eine Flüssigkeit herzustellen, die alle Eigenschaften von menschlichem Blut besitzt. Die Forscher konzentrieren sich daher heute auf die wichtigsten Funktionen: den Sauerstofftransport und den Ausgleich von hohen Blutverlusten.
Bei den ersten Blutersatzprodukten kollabierten aber bereits nach kurzer Zeit die Kapillaren, weil sie dem Bedarf des umgebenden Gewebes nicht nachkommen konnten. Es entstand ein Unterdruck. Forscher hatten fälschlicherweise angenommen, dass künstliches Blut dünner als natürliches sein müsse, damit es besser zirkuliert. Und noch ein Denkfehler unterlief ihnen: Sie dachten, Sauerstoff könne besser wieder freisetzt werden, wenn die Bereitschaft, ihn zu binden, eher gering ist. Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass der Sauerstoff zu früh und damit nutzlos in den Arterien anstatt in den Kapillaren freigesetzt wird.