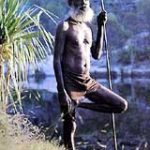Das Barriereriff zerteilt das Wasser wie eine klare Grenze zwischen dem Leben in der Lagune und der Unterwasserwelt des philippinischen Ozeans: Ein Platz, wo sich zwei Lebensräume überschneiden und besonders hohen Artreichtum bietet. Drei große Meeresströmungen laufen in Palaus Gewässern zusammen. Sie beliefern mehr als 1.200 Quadratkilometer Riff mit Nährstoffen und Fischarten aus allen tropischen Meeren.
An der Riffkante tummeln sich die Hochseefische und warten darauf, dass die Ebbe nährreiches Wasser ausnahmsweise aus der Lagune ins offene Meer hinausträgt. Ein riesiger Schwarm Querbänder-Barrakudas überholt ein paar Gelbflossen-Thunfische und Riesenmakrelen. Doch aus dem weiten Blau nähern sich bereits die Herren des Riffs, die Anführer der Nahrungskette: Eine Gruppe von Grauen Riffhaien, die sich neugierig das Nahrungsangebot ansieht. Nach einigen Streifzügen entlang der Riffkante aber scheinen die drei Meter langen Exemplare den Hunger zu verlieren und drehen ab. Dabei werden sie von kleinen Großaugen-Stachelmakrelen verfolgt, die sich erst einzeln der Flosse des Hais nähern, um dann seitlich direkt auf Hautkontakt zu gehen. Forscher nehmen an, dass die Makrelen so die raue Haut der Haie wie Sandpapier nutzen, um ihre eigenen Hautunreinheiten abzuschmirgeln.
Auf einmal löst sich ein runder Schatten vom Riff und dreht mit einigen kräftigen Stößen eine Kurve durch das Revier der Großtiere. Die knapp ein Meter lange Hawksbill-Schildkröte wendet sich anschließend wieder gemütlich dem Plateau zu und landet zwischen dem regen Treiben der Rifffische. Die größeren Fische gleiten über den Trubel der winzigen Korallenfische hinweg, die durch das Netz der verzweigten Korallenarme sausen. In den Zwischenräumen verstecken sich Blaue Seesterne, Warzenschnecken und Muscheln.

Hinzu kommen über 300 Arten Krustentiere, mehr als 200 Weichtiere und etwa 120 Arten von Stacheltieren, wie Seeigel, Seesterne oder Seegurken. Um in dem Wirrwarr überhaupt noch aufzufallen braucht man schon eine Sonderaustattung, wie die blinkende Disko-Muschel: Die zehn Zentimeter breite Muschel hat ihre Schalen weit aufgesperrt und erzeugt in ihrem Innern einen zitternden Lichtstrahl, der ihre Beute fasziniert anlockt. Lichteffekte als Köder zu nutzen, ist besonders bei Tiefseelebewesen durchaus verbreitet. Hinter dem Leuchten, als Bioluminiszenz bezeichnet, steckt eine chemische Reaktion. Das Enzym Luciferase spaltet mit Hilfe von Sauerstoff Teilgruppen von dem Protein Luciferin ab. Dabei entsteht Energie, die als Licht abgegeben wird. Die Disko-Muschel erzeugt so einen blitzartigen Lichteffekt, der sofort ins Auge springt.