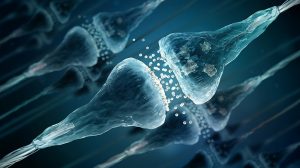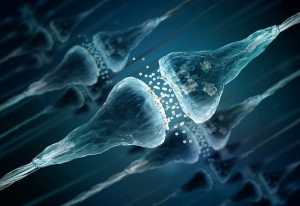Als die ersten wissenschaftlichen Grundlagen für die aktuell verwendeten maschinellen Lernverfahren in den 1950er-Jahren entwickelt wurden, hatte man nur grobe Vorstellungen davon, wie das Lernen im Gehirn auf der Ebene der Neuronen funktioniert. Die Algorithmen, die daraus resultierten, sind unzweifelhaft sehr leistungsfähig – ebenso unzweifelhaft ist aber auch, dass diese Verfahren so, wie sie heutzutage implementiert sind, in der Natur nicht vorkommen.

Lernen mit Schwächen
Auf diesem Manko, könnte man spekulieren, beruhen viele der Beschränkungen, denen die Künstliche Intelligenz heute noch unterliegt. Eine typische Schwachstelle von KI-Systemen ist beispielsweise ihre Abhängigkeit von einer riesigen Menge an Lernbeispielen, eine weitere Schwäche ist ihre mangelnde Fähigkeit zu abstrahieren oder korrekt zu verallgemeinern. Das kann beispielsweise dazu führen, dass KI-Systeme „Vorurteile“ entwickeln.
Auch die fehlende Einbettung in einen kontinuierlichen Zeitablauf ist ein Defizit aktueller KI-Systeme. Doch nur dann können das Lernen, die Anpassung an die Umgebung und das Handeln eng miteinander verwoben und von einem gemeinsamen inneren Zustand bestimmt und koordiniert werden. Erst wenn Maschinen diese Fähigkeiten besitzen, wird es ihnen möglich, selbstständig komplexe Aufgaben in einer natürlichen Umwelt zu übernehmen.
Abgucken beim realen Vorbild
Wie kann man diese Schwachstellen angehen und lösen? Wir setzen in unserer Arbeitsgruppe auf das „neuromorphe Rechnen“, eine Forschungsrichtung, deren Grundannahme es ist, dass man das natürliche Vorbild nur genau genug studieren und die Mechanismen der Natur nur gut genug verstehen muss, um Antworten zu erhalten.