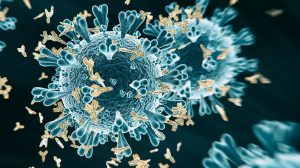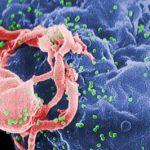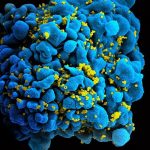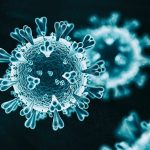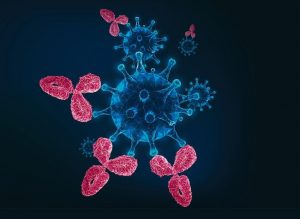Während unser Immunsystem oft eine Mischung verschiedener Antikörper gegen einen Erreger produziert, will man für ein optimales Antikörper-Heilmittel meist nur den effektivsten und spezifischsten dieser Immunglobuline einsetzen. Dank biotechnologischer Fortschritte lassen sich solche maßgeschneiderten Antikörper heute im Labor herstellen. Auch gegen SARS-CoV-2 sind schon mehrere solcher sogenannten monoklonalen Antikörper in Arbeit.

Wie produziert man monoklonale Antikörper?
Das klassische Verfahren zur Herstellung von monoklonalen Antikörpern ist die sogenannte Hybridom-Technik. Dabei wird zunächst ein Versuchstier, beispielsweise eine Maus, mit geringen Dosen des Zielvirus infiziert. Darauf bildet sie antikörperproduzierende B-Zellen, die die Forscher nun entnehmen. Um nun diese B-Zellen in Kultur halten und vermehren zu können, werden sie mit einer Tumorzelllinie verschmolzen – entarteten Zellen, die sich nahezu unbegrenzt teilen können. Als Folge entstehen Hybridzellen, die Hybridome, die sich genauso gut vermehren wie die Tumorzellen aber weiterhin die Antikörper produzieren.
Jetzt folgt die Selektion: Um herauszufinden, welche der oft hundert oder tausend verschiedenen B-Zelllinien die optimalen Antikörper produzieren, unterziehen Forscher sie einem Bindungstest. Dafür haben sie genau das Stück des Virusproteins isoliert, an das der Antikörper später andocken soll. Findet diese Anlagerung statt, signalisiert dies ein Farbumschlag.
Damit ist der Antikörper gefunden, der wie ein Schlüssel zum Schloss auf das virale Protein passt und der im Idealfall das Virus neutralisieren kann. Diese maßgeschneiderten Antikörper können nun entweder biochemisch nachgebaut und in Massen hergestellt werden. Oder man vermehrt die B-Zelllinie, die diese Antikörper erzeugt und nutzt sie zur Massenproduktion. Weil diese Antikörper alle aus derselben B-Zelllinie kommen, werden sie als monoklonale Antikörper bezeichnet.