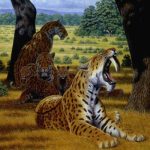Eine Art gilt dann als ausgestorben, wenn sie nicht nur an einem bestimmten Ort, sondern überall auf der Welt verschwunden ist. Im Gegensatz zu lokal begrenzten Aussterben ist dies in der Regel endgültig. Zwar kommt es manchmal vor, dass von vermeintlich Ausgestorbenen plötzlich doch noch Vertreter gefunden werden, doch solche „Lazarus-Arten“ wie der Quastenflosser sind eher die Ausnahme.
So weit, so gut. Aber was unterscheidet die „normalen“ Aussterbeereignisse von den Massenaussterben? Gibt es handfeste Kriterien, die die großen Katastrophen vom „Hintergrundrauschen“ absetzen? Oder bestehen zwischen beiden graduelle Übergänge?
Dieser Frage sind 1982 unter anderem John Sepkoski und David Raup von der Universität Chicago nachgegangen. Sie trugen für die letzten 560 Millionen Jahre jeweils die Anzahl der ausgestorbenen Arten über der Zeit in ein Diagramm ein und werteten die Daten statistisch aus. Tatsächlich schienen fünf Zeitperioden aus der Menge der anderen Ereignisse deutlich herauszuragen. Doch ein anderer Wissenschaftler, James Quinn von Universität von Kalifornien, unterzog diese Daten ebenfalls einer statistischen Prüfung und stellte fest, dass die fünf herausragenden Ereignisse rein statistisch gesehen nicht sehr signifikant waren.
Die „großen Fünf“
Gibt es also außer der schieren Menge der ausgestorbenen Arten keine Kennzeichen für Massenaussterben? Nach Ansicht von David Raup stechen die „großen Fünf“ tatsächlich nur deshalb hervor, weil Aussterben in diesem Umfang selten ist: „Das Aussterben am K-T-Übergang war ein 100-Millionen-Jahr Ereignis, und so was wie am Ende des Perm kommt im Durchschnitt vermutlich höchstens alle 600 Millionen Jahre vor,“ erklärt der Paläontologe. „Es könnte aber auch sein, dass ein Aussterben wie am Ende des Perm im Durchschnitt alle 200 Millionen Jahre vorkommt und es nur durch einen Zufall in den letzten 600 Millionen Jahren nur einmal auftrat.“