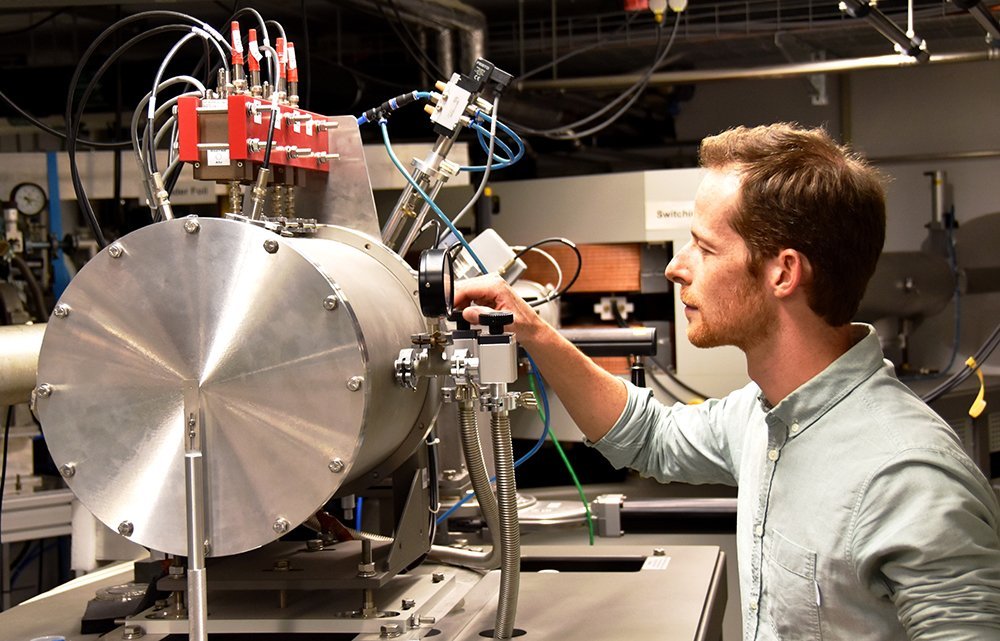Sind die Brennelemente aus einem abgeschalteten Atomkraftwerk entfernt, beginnt die Hauptarbeit. Doch bevor ein Betreiber die offizielle Genehmigung für die Stilllegung und damit den Rückbau bekommt, muss er detaillierte Pläne für das weitere Vorgehen vorlegen und – vor allem – für jedes Bauteil zunächst einmal messen, wie stark radioaktiv kontaminiert es ist.

Kontamination ist nicht gleich Kontamination
Doch diese Messungen sind alles andere als einfach. Zum einen sind viele Bauteile anfangs noch gar nicht zugänglich und können daher erst dann ausgemessen werden, wenn der Rückbau schon im Gang ist. Zum anderen aber gibt es zwei verschiedene Arten der Kontamination, die jeweils eigene Messverfahren erfordern.
Der erste Fall ist die direkte Kontamination durch Kontakt mit den im Reaktorkern erzeugten Radionukliden. Diese Zerfallsprodukte, darunter radioaktives Cäsium und Strontium, können durch Mikrorisse in den Brennstabhüllen ins Kühlwasser übergehen. Im Laufe der Zeit lagern sie sich dadurch unter anderem an den Wänden des Reaktorkerns und an den Oberflächen der Leitungen, Pumpen und Ventile des Primär-Kühlkreislaufs ab. Diese Radionuklide lassen sich meist relativ gut nachweisen – teils über ihre Gammastrahlung, teils über direkte Nachweismethoden.
Durch Neutronen aktiviert
Anders ist dies mit der sogenannten Aktivierung. Sie wird durch die Neutronen verursacht, die beim Kernzerfall im Reaktor freigesetzt werden. Diese Elementarteilchen können tief in Beton, Stahl und andere Materialien eindringen und sogar den Stahlbehälter des Reaktorkerns durchschlagen. Wenn diese Neutronen mit den Atomkernen des Baumaterials kollidieren, werden sie absorbiert und verändern die Neutronenzahl im Atomkern – es entsteht ein neues, oft radioaktives Isotop dieses Elements.