-
Charakteristische Merkmale der mittelalterlichen Stadt:
- Keimzellen der mittelalterlichen Städte sind die Überreste von römischen Städten, Pfalzen, kirchlichen Institutionen und Wiken (= kaufmännische Siedlungen)
- der Stadtumriss wird den topographischen Gegebenheiten angepasst
- Schutz gewährt eine Stadtmauer, ein Wall und/oder ein Graben
- Dom, Rathaus und Stadtmauer sind die weithin sichtbaren Wahrzeichen der Stadt
- Mittelpunkt ist der Markt. Durch seine Gestaltung wird die Individualität der Städte ausgedrückt. Es kann in einer Stadt auch mehrere Märkte geben, die alle eine andere Funktion haben und die man heute noch anhand ihrer Namen erkennen kann (zum Beispiel Viehmarkt, Fischmarkt, Heumarkt).
- der Kirchturm ist neben dem Rathaus die höchste Erhebung und dient auch als Ausguck
- bürgerliche Bauten bestimmen das Stadtbild und stehen dicht gedrängt innerhalb der Stadtmauer
- unregelmäßiges Straßennetz
- im Gegensatz zu griechischen und römischen Städten gibt es im Mittelalter keinen einheitlichen Stadtbaustil
- jede Stadt hat verschiedene Stadtteile mit eigenem Charakter, ein eigenes Wappen und eine eigene politische Verwaltung
- Wertgefälle von innen nach außen: Die Wohlhabenden leben im Zentrum, die Armen am Stadtrand.
Weiter geht die Reise in die Vergangenheit: Das Mittelalter, Zeitalter zwischen Antike und Neuzeit, beginnt ungefähr 500 nach Christus und endet circa tausend Jahre später. Nach dem Niedergang des römischen Reiches geht in Italien, Gallien, Germanien und Britannien auch das städtische Leben deutlich zurück, teilweise verschwindet es sogar völlig. Die Menschen wandern wieder auf das Land ab, wo sie noch die meisten Überlebenschancen haben. Erst um die Jahrtausendwende entstehen im heutigen Westeuropa eine neue Wirtschaft und Kultur – die Städte erleben einen neuen Aufschwung.
Weil es auf dem Land nicht genügend Arbeit gibt, wandern wieder viele Menschen in die Städte ab. Sie versprechen sich vom Stadtleben einen allgemein besseren Lebensstandard und ein höheres Einkommen. Außerdem können die Menschen in der Stadt frei werden und der strengen Ordnung der Ständelehre entfliehen („Stadtluft macht frei.“) – ein großer Anreiz für die Landbevölkerung. Um das zu erreichen muss man „nur“ ein Jahr und ein Tag in der Stadt bleiben, vorausgesetzt der Herr erhebt in der Zwischenzeit keine Ansprüche. Hat man diese Zeit überstanden darf man für immer frei in der entsprechenden Stadt bleiben. Die Menschen auf dem Land sind hingegen rechtlos und müssen ihrem Grundherrn Frondienste leisten und Abgaben zahlen.
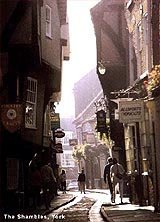
Mittelalterliche Städte verändern durch Stadterweiterungen häufig ihr Gesicht. Denn mit der Zeit werden die befestigten Stadtanlagen des frühen Mittelalters – die Burgen – zu klein für all die Neuankömmlinge. Deshalb beginnen die Menschen neue Siedlungen vor den Toren der Stadt zu bauen, die schon in kurzer Zeit größer sind als die ursprünglichen Städte selbst. Als Folge muss eine zweite Stadtmauer zum Schutz der neuen Vorstädte errichtet werden. Obwohl das mittelalterliche Stadtleben härter ist, als die Menschen es erwartet haben – geprägt durch hohe Arbeitslosenzahlen, Kinderarbeit, Hunger, schlechte medizinische Versorgung und mangelhafte hygienische Verhältnisse – wachsen die Städte unaufhörlich und müssen mehrmals erweitert werden.
Das Extrembeispiel mittelalterlicher Stadterweiterungen ist Köln: Im Jahr 1106 verdoppelt sich die Größe der Stadt nahezu von 120 auf 236 Hektar. Ab 1180 – mit dem Bau der großen Stadtmauer, die die größte Befestigungsanlage nördlich der Alpen ist – wächst Köln auf 400 Hektar an. Damit ist Köln flächenmäßig die größte Stadt Mitteleuropas, und außerdem mit 40.000 Einwohnern die größte deutsche Stadt des Mittelalters.






