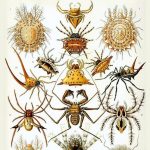Seit den düsteren Zeiten der Naturkundemuseen hat sich nicht nur die Art der Exponatbeschaffung geändert, sondern auch, wie diese den Besuchern präsentiert werden. Das hängt auch mit dem Imagewandel zusammen, den Museen im Laufe der Jahrhunderte durchlaufen haben. Waren die ersten Naturalienkabinette und Schatzkammern nur einer handverlesenen Elite vorbehalten, so sehen es heutige Naturkundemuseen als eine ihrer Kernaufgaben, ihr Wissen verständlich an die breite Öffentlichkeit weiterzugeben.

Museen öffnen für alle
Früher wurde die breite Masse bewusst von den fürstlichen Sammlungen ferngehalten. So war es zum Beispiel im Jahr 1721 „Lacquaien, Handwerksburschen, Jungen, Mägden“ verboten, den Ausstellungsraum der Leipziger Ratsbibliothek zu betreten. Selbst der Besuch höherrangiger Personen war vielerorts beschränkt. Im Braunschweiger Kunst- und Naturalienkabinett durften sich einst nur maximal zwanzig Gäste pro Tag umsehen.
Erst ab Ende des 18. Jahrhunderts, im Zuge von Aufklärung und Revolution, öffnen die Museumspforten für alle Menschen. „Das Ziel der Museumsentwicklung ist ab nun die Wohlfahrt der Gesellschaft als Ganzes“, erklärt Museologe Gottfried Fliedl. Die Ausstellungen sollten nun didaktisch aufbereitet werden, sodass jeder Besucher unabhängig von Stand und Bildung sie verstehen konnte. Daher gab es jetzt Infotafeln, Karten, Vorträge und Führungen.
Ende des 19. Jahrhunderts formierte sich sogar langsam eine eigene Berufsgruppe, die dem Publikum das Wissen über die Exponate angemessen und verständlich vermitteln sollte: die Museumspädagogen. Sie analysieren Zielgruppen, organisieren Führungen, erarbeiten Lehrmaterial. Mittlerweile vernetzen sie sich auf speziellen Fachtagungen mit Titeln wie „Images of Nature. Welches Bild vermitteln wir in unseren Ausstellungen?“ oder „Methoden des Zeigens“ und suchen nach Ideen für neue Ausstellungskonzepte.