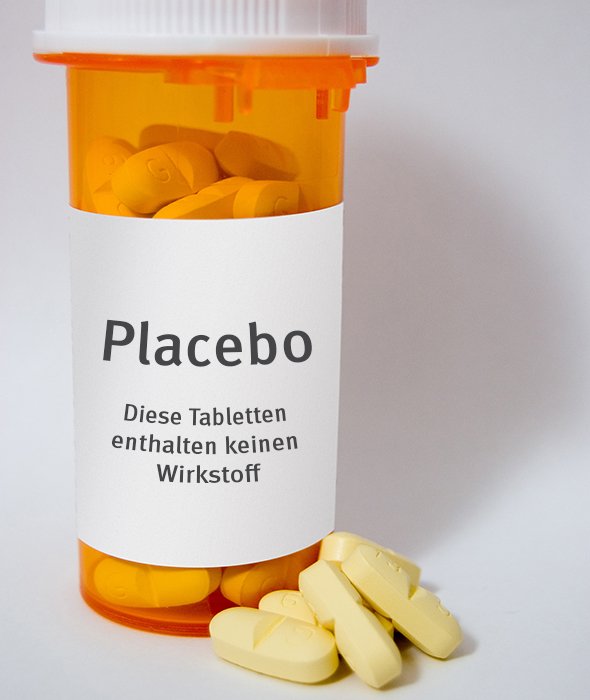Was löst einen Placebo-Effekt aus? Muss man fest an die Wirkung einer Behandlung glauben, um einen Placebo-Effekt zu erfahren? Jahrzehnte der Placebo-Forschung haben zumindest einige dieser Fragen geklärt – und teilweise überraschende Antworten geliefert. Relativ klar ist heute, welche psychologischen Mechanismen den Placebo-Effekt oder seine negative Kehrseite auslösen. Nach gängigem Wissensstand spielen dabei vor allem zwei Faktoren eine wichtige Rolle: die Erwartung und die klassische Konditionierung.

Die Erwartungen sind entscheidend
Ein klassisches Beispiel für ersteres: Freiwillige haben sich für einen Test der Schmerzempfindlichkeit gemeldet. Alle erhalten zuvor eine Creme, die auf ihrem Handrücken verstrichen wird. Der Hälfte der Probanden wird gesagt, dass es dies nur der Desinfektion dient, der anderen, dass es sich um ein starkes Betäubungsgel handelt. Prompt fallen die Reaktionen auf den folgenden Schmerzreiz ganz unterschiedlich aus: Glauben die Teilnehmer, ihre Hand wäre betäubt worden, empfinden sie subjektiv deutlich weniger Schmerzen – weil sie genau diesen Effekt erwarten.
Nicht immer aber sind es explizite verbale Informationen, die die Erwartungen prägen und den Placebo-Effekt fördern. Studien zeigen, dass schon die Wortwahl, der Tonfall oder der Gesichtsausdruck eines Arztes oder Experimentators ausreichen, um die Erwartungen und damit den Effekt zu beeinflussen. Selbst nicht bewusst wahrgenommene, unterschwellige Signale reichen für den Effekt aus.

Rote Pillen und erlernte Reaktion
Und auch die Art der Placebo-Behandlung spielt eine Rolle – weil auch sie unsere Erwartungen prägt: So wirken rote Placebo-Tabletten besser als weiße, eine Injektion besser als eine Pille und ein teures Scheinpräparat löst einen stärkeren Effekt aus als ein billiges. Schmeckt eine Arznei bitter, fördert dies ebenfalls die Placebo-Wirkung, wie Studien zeigen. Je mehr Umstand und Aufwand bei einer Therapie getrieben wird, desto besser wirkt sie – zumindest was den Placebo-Effekt angeht.