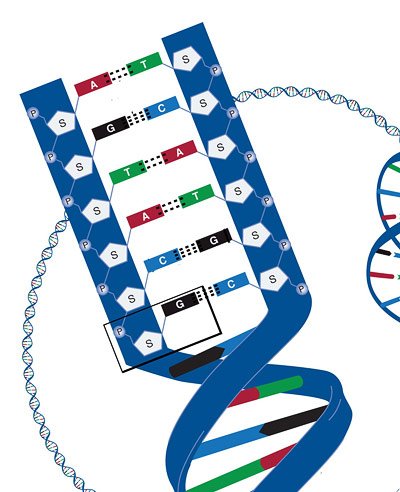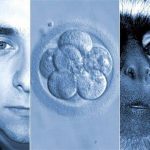Wie aber sieht die rechtliche Grundlage für diese und andere Entscheidungen überhaupt aus? Was ist laut Patentrecht patentierbar? Im Prinzip muss ein Patent nur drei Kriterien genügen: Es muss vom Menschen erfunden, neu und nicht offensichtlich sein, so legt es das europäische Patentrecht fest. Doch vor allem die erste dieser Regeln hat es in sich.
Kriterium der Erfindung
Gerade in der Debatte um Genpatente spielt dieses Kriterium immer wieder eine entscheidende Rolle. Problematisch ist dabei vor allem das Fehlen einer einheitlichen Definition des Begriffs „Erfindung“. Dadurch existieren je nach Institution oder Land teilweise höchst unterschiedliche Ansichten dazu, was als Erfindung gelten kann und was nicht. Das Deutsche Bundesverfassungsgericht etwa umschrieb noch Ende der 1960er Jahre die Erfindung als „Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur unmittelbaren Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges“. Etwas verständlicher formuliert es der deutsche Bundesgerichtshof heute: „Patentierbar ist eine Lehre zum technischen Handeln, das heißt eine Instruktion, wie man ein technisches Problem löst.“
Doch wie lässt sich das auf die heutigen Biopatente anwenden? Weil gerade dort in der Regel eben keine eindeutigen technischen Neuerungen patentiert werden sollen, greift die klassische Definition hier ins Leere. Leichter haben es da die Amerikaner, in deren Patentgesetz eine Erfindung nur sehr allgemein als „menschlicher Eingriff, der zur Entdeckung oder Erfindung eines Prozesses, einer Maschine, eines Fabrikats oder der Verbindung von Stoffen, oder einer Verbesserung davon führt.“ Immerhin könnte man Gene eindeutig als „Verbindungen von Stoffen“ deklarieren.
Aber wo beginnt in diesem Fall die Erfindung und wo endet die bloße Entdeckung? Für die Diskussion um die Genpatente ist genau dies die entscheidende Frage, bei der auch die beliebte Faustregel: „Eine Entdeckung bereichert das menschliche Wissen, eine Erfindung das menschliche Können“ kaum weiterhilft. Entsprechend unterschiedlich sind die Interpretationen dessen, was ein Genpatent enthalten muss, um es von der reinen Entdeckung zur Erfindung zu adeln.