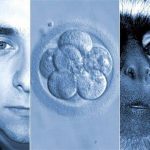Während die Wissenschaft noch darüber streitet, ob Eingriffe in die menschliche Keimbahn ethisch verwerflich, vertretbar oder vielleicht sogar geboten sind, gibt es aus der Genforschung Neues zu den möglichen Folgen solcher Geneditierungen. Denn es mehren sich die Hinweise darauf, dass die Genschere CRISPR/Cas9 weniger zielgerichtet wirkt als bislang angenommen – und dass ihr Einsatz bei Embryos zahlreiche unerwünschte Veränderungen am Erbgut nach sich zieht.

Bis zu 20.000 DNA-Basen verschwunden
Das Problem beruht auf einer Grundeigenschaft der Genschere: Sie schneidet zwar den defekten oder unerwünschten DNA-Abschnitt gezielt aus dem Erbgut aus. Die Reparatur dieses Schnitts und das Einfügen der fehlenden Basenabfolge übernimmt aber die Zelle selbst. Doch gerade in Keimzellen und im frühen Embryo scheint der Einsatz dieser zelleigenen DNA-Reparatursysteme häufiger als erwartet zu großräumigen Fehlern und Umbauten im Erbgut zu führen.
Ein Team um Gregorio Alanis-Lobato vom Francis Crick Institute in London hatte CRISPR/Cas9 eingesetzt, um bei menschlichen Embryonen eine Mutation im sogenannten POU5F1-Gen auf Chromosom 6 zu editieren. Nachfolgende Analysen enthüllten jedoch, dass nicht nur die gewünschte Änderung erfolgt war, sondern dass in angrenzenden Teilen des Chromosoms ganze Abschnitte fehlten oder umgelagert waren. Im Chromosom fehlten dadurch bis zu 20.000 Basenpaare.
„Solche unerwünschten Folgen der Geneditierung waren in rund 16 Prozent der von uns embryonalen Zellen präsent“, berichteten die Forschenden im Sommer 2020 (bioRxiv, doi: 10.1101/2020.06.05.135913).