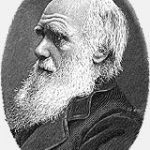Noch weitaus aufwendiger ist die Arbeit in den artenreicheren Tropen. Das erlebt Christian Roos vom Deutschen Primatenzentrum – Leibniz-Institut für Primatenforschung (DPZ) in Göttingen auf seinen Reisen nach Südostasien immer wieder. Roos ist einer jener Taxonomen, die nicht nur die Morphologie der Tiere kennen, sondern auch die molekulargenetischen Methoden. Er ist Spezialist für Primaten. Umgangssprachlich gesagt: Er erforscht Affen.

Verschiedene Makis
Mit Peter Kappeler, dem Leiter der Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie am DPZ, hat er schon einige evolutionäre Verwandtschaftsbeziehungen klären können, etwa beim Riesenmausmaki auf Madagaskar. Kappeler stellte bei Beobachtungen auf Madagaskar fest, dass sich die Tiere im Norden und Süden der Insel ganz unterschiedlich verhalten und auch unterschiedlich aussehen.
Roos analysierte ihr Erbgut und stellte fest, dass es sich beim nördlichen und südlichen Typ um zwei verschiedene Arten handelt. „Dank der Molekulargenetik können wir wichtige Hinweise für den Artenschutz geben“, sagt Roos. Denn Schutzgebiete lassen sich nur dann sinnvoll einrichten, wenn bekannt ist, wo welche Art vorkommt – oder ob es sich, wie beim Riesenmausmaki, um verschiedene Arten handelt. Roos nennt ein anderes Beispiel: „Früher dachten Taxonomen, dass es auf Madagaskar nur eine Wieselmaki-Art mit sieben Unterarten gibt – dank Genanalyse wissen wir inzwischen, dass es 26 Arten sind.

Volkszählung im Ozean
Entscheidend waren Taxonomie und genetische Artanalysen auch für ein globales Mammutprojekt, den Census of Marine Life. Zehn Jahre lang haben Forscher für diese Volkszählung im Ozean in 14 verschiedenen Projekten die Meere und marinen Lebensräume der Erde durchforstet. Und auch hier war eines der Ziele, diese Lebenswelt besser kennenzulernen, um sie besser schützen zu können.
Die Spanne der Neuentdeckungen reichte von ölschluckenden Würmern über die Yeti-Krabbe bis hin zu Riesen-Schwefelbakterien. Und auch hier waren und sind es die Taxonomen, die dafür sorgen, dass die tausenden von kartierten, dokumentierten und gesammelten Arten bestimmt oder offiziell beschrieben werden. Dies wird noch Jahrzehnte dauern, auch wenn ihre Arbeit in Teilen bereits vom DNA-Barcoding erleichtert wird.
Tim Schröder / Leibniz Journal
Stand: 07.08.2015