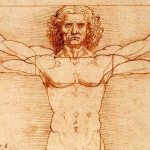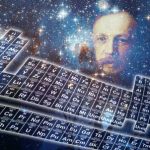Bärtige Gestalten in seltsamen Gewändern, die in einem kargen Kellerraum mit rauchenden Tiegeln und brodelnden Tinkturen hantieren und dabei geheimnisvolle Sprüche murmeln – so ähnlich stellen wir uns heute meist Alchemisten vor. Irgendwo zwischen Quacksalberei und Magie angesiedelt verschrieben diese Pseudogelehrten ihr Leben der Suche nach dem Stein der Weisen und dem Rezept, mit dem sich Blei zu Gold machen lässt, so die gängige Annahme.
Zwischen hoffähig und verboten
Doch dieses Bild trifft nur zum Teil. Denn in Mittelalter und Renaissance war die Alchemie ein ebenso verbreitetes und zeitweilig durchaus angesehenes Fachgebiet wie andere Wissenschaften auch. Im 13. Jahrhundert war die Alchemie sogar bei einigen mittelalterlichen Universitäten hoffähig – bis dann in einigen Regionen sogar Gesetze erlassen wurden, die die Produktion von Alchemistengold unter Strafe stellten.
Das allerdings hinderte so berühmte Gelehrte wie Francis Bacon, Robert Boyle, Paracelsus oder John Dee, den Hofastrologen und Berater der englischen Königin Elisabeth I., nicht daran, sich alchemistischen Studien zu widmen. Selbst ein unbestritten seriöser Wissenschaftler wie Isaac Newton beschäftigte sich noch im 17. Jahrhundert mit der Alchemie und beschrieb in einem erst vor kurzem entdeckten geheimen Manuskript ein Rezept für den begehrten Stein der Weisen.
Schwarze Magie
Für Misstrauen sorgte allerdings immer wieder die Geheimnistuerei der Alchemisten, die ihre Rezepturen und Methoden nur selten offenlegten. Viele von ihnen studierten zudem die Schriften arabischer und jüdischer Gelehrter, die damals dem Wissen der Europäer in vielem weit voraus waren. Auch das rückte sie verdächtig in die Nähe der Häresie.