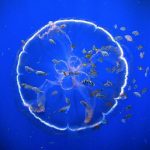Eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit ist die nachhaltige Versorgung der Menschheit mit gesunder und ausreichender Nahrung – und im Speziellen mit Protein. Denn der menschliche Körper benötigt reichlich Nahrungseiweiß, unter anderem für den Aufbau von Muskeln, Organen, Knochen und Haut.

Keine Abhilfe gegen die Überfischung
Bisher decken wir unseren Proteinbedarf meist durch tierische Produkte wie Fleisch oder Fisch. Bei letzteren stehen die großen Raubfische, wie Lachs oder Thunfisch, weit vorn auf dem Speiseplan. Allein in Deutschland wurden 2016 rund 2,2 Millionen Tonnen Fisch und Meeresfrüchte verzehrt. Ein Großteil dieses Fischs stammt aus Aquakulturen: Der Lachs kommt primär aus Norwegen, Pangasius und Garnelen werden in Asien gezüchtet und Forellen kommen vorwiegend aus Zuchten in Osteuropa.
„Leider ist das überhaupt nicht nachhaltig“, sagt Holger Kühnhold vom Leibniz-Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT). „Diese Fische benötigen zum Wachsen ein Vielfaches ihres Eigengewichts an kleinen Fischen. Auch in Aquakultur muss dieser Bedarf mit Fischmehl und -öl von Wildfischen gedeckt werden.“ Der Boom der Aquakultur fördert damit paradoxerweise die Überfischung der Meere, der sie eigentlich durch die Zucht von Speisefischen entgegen wirken soll. Aber weil für das Futter der Zuchtfische große Mengen an kleineren Fischen weggefangen werden, sind auch deren Bestände inzwischen ausgedünnt.
Überdüngung und Parasiten
Hinzu kommt, dass durch die Haltung so vieler Fische auf engstem Raum Unmengen an Kot und ungefressenem Futter in die Meeresumwelt gelangen Die Folge ist eine Überdüngung der küstennahen Ozeane rund um die Aquakulturen. Vor der Insel Hainan im südchinesischen Meer haben jahrzehntelange Aquakulturen von Garnelen und Zackenbarschen das Meer so stark eutrophiert, dass die ursprünglich dort wachsenden Seegraswiesen immer weiter zurückgegangen sind und Meeresalgen diesen Lebensraum überwuchern, wie Wissenschaftler des Leibniz-Zentrums für Marine Tropenforschung (ZMT) festgestellt haben.