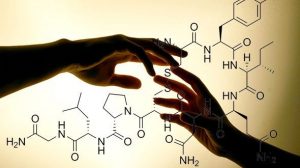Lange schien das menschliche Sexualverhalten ebenso klar wie eindimensional: Zu einem Mann gehört eine Frau, beide bekommen Kinder und fertig. Noch weit bis ins 20. Jahrhundert hinein galt die Heterosexualität als die sexuelle Norm – alles andere galt als widernatürlich oder krank. Erst in den 1970er Jahren wurde Homosexualität offiziell aus dem Katalog psychischer Erkrankungen und Störungen, dem sogenannten DSM, herausgenommen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO strich Homosexualität sogar erst 1990 aus ihrem Katalog.

Komplexes Zusammenspiel
Heute ist klar, dass unsere sexuelle Orientierung nicht so simpel schwarz-weiß gestrickt ist – und dass Homosexualität und Bisexualität zur natürlichen Bandbreite menschlichen Verhaltens gehören. Welche sexuelle Orientierung ein Mensch hat, wird durch ein komplexes Zusammenspiel von Faktoren bestimmt. Sie beeinflussen, ob wir uns eher von einem Mann oder einer Frau sexuell angezogen und erregt fühlen, welches Geschlecht in unseren Fantasien auftaucht und auch, mit wem wir Sex haben.
Dieses komplexe Zusammenspiel von Empfinden, unwillkürlichen Reaktionen und Handeln macht es nicht unbedingt leichter, die sexuelle Orientierung zu definieren – und sie zu erforschen. Die Schwierigkeiten beginnen schon bei der Einordnung: Ob jemand heterosexuell, homosexuell oder auch bisexuell ist, kann letztlich nur er selbst ermessen. Forscher sind deshalb größtenteils auf die Selbsteinschätzung der Teilnehmer angewiesen.
Wie hoch ist der Anteil?
Das gilt auch für Studien zum Anteil homosexueller Frauen und Männer an der Bevölkerung. Der berühmte Sexualforscher Alfred Kinsey ging in den 1940ern noch von mindestens zehn Prozent homosexuellen Männern und Frauen aus. Heute gilt dies aber als zu hoch gegriffen. Moderne Erhebungen kommen eher auf Anteile von weniger als 1,5 Prozent lesbischer Frauen und bis zu 3,5 Prozent schwuler Männer. Als bisexuell bezeichnen sich meist nur rund ein Prozent der Teilnehmer.

Im Umkehrschluss bedeutet dies: Rund 95 Prozent der Menschen sind heterosexuell, rund fünf Prozent sind es nicht. Ähnliche Anteile finden sich dabei in nahezu allen Kulturen – ob Naturvolk oder Stadtbewohner. „Es gibt bisher keine überzeugenden Belege dafür, dass sich die Rate der gleichgeschlechtlichen Anziehung im Laufe der Zeit oder der geografischen Position stark verändert hat“, sagt Michael Bailey von der Northwestern University.
Gegensätze oder Kontinuum?
Ist unsere sexuelle Orientierung ein Entweder-Oder oder sind die Übergänge fließend? Diese Frage erscheint auf den ersten Blick wenig relevant, doch bei der Suche nach den Ursachen für Homo- und Heterosexualität kann sie wertvolle Hinweise liefern: „Eine zweigipflige Verteilung würde implizieren, dass die sexuelle Orientierung schon in frühem Alter festgelegt ist“, erklären die britischen Psychobiologen Glenn Wilson und Qazi Rahman. Sind dagegen Zwischenformen häufig, könnte dies eher darauf hindeuten, dass soziale Einflüsse, Lernerfahrungen oder die Lebensweise entscheidend sind.
Tatsächlich zeigen Studien: Die sexuelle Orientierung ähnelt eher einer einseitig erhöhten U-Kurve als einer Glockenkurve. Konkret bedeutet dies, dass beide Extreme – Hetero- und Homosexualität – häufiger vorkommen als bisexuelle Zwischenformen. Das spricht dagegen, dass die sexuelle Orientierung des Menschen ein Kontinuum mit fließenden Übergängen bildet. Allerdings gibt es dabei Unterschiede zwischen Männern und Frauen: Bei Frauen kommt Bisexualität und auch ein Wechsel der sexuellen Orientierung im Verlauf des Lebens etwas häufiger vor als bei Männern.
Die noch von Kinsey und seinen Kollegen vertretene Theorie, dass fast jeder Mensch „ein bisschen bi“ ist, trifft demnach wahrscheinlich nicht zu. Zwar gibt es Menschen, die sich als bisexuell erleben und definieren, sie sind aber eine kleine Minderheit – nicht die Regel.
Nadja Podbregar
Stand: 29.06.2018