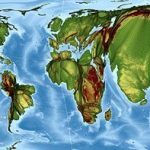Weil viele Minderheiten glauben, ihre Sprachen seien nutzlos, wollen die Wissenscha¬ftler die Sprecher dazu bringen, sie selbst zu dokumentieren – und so deren unschätzbaren Wert zu erkennen. Das ist auch das erklärte Ziel von Bruna Franchetto. 1976 reiste die Italienerin das erste Mal an den Oberlauf des Rio Xingu im brasilianischen Amazonasgebiet, um die Sprache der
Kuikuro zu erforschen, eines indigenen Volksstamms, der sich bereits im 9. Jahrhundert n. Chr. dort niederließ.

Seit über drei Jahrzehnten besucht sie die Dörfer der Kuikuro und sah über die Jahre, wie Fernsehen, westliche Kleidung, Bücher, Autos und Portugiesisch mehr und mehr die Kultur der Kuikuro infiltrierten – und deren Sprache bedrohten. „Von Anfang an lautete aber der Plan“, so die Anthropologin vom Museu Nacional der Universidade Federal in Rio de Janeiro, „die Kuikuro vom Forschungsobjekt zu tatsächlichen Akteuren zu machen – sie selbst zu ermächtigen.“ Als Franchetto und ihr Team 2001 ihre Forschungen im Rahmen von DobeS fortführten, sollte diese
Idee Wirklichkeit werden. Die jahrelangen Vorarbeiten haben dafür eine Vertrauensbasis geschaffen.