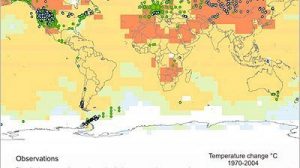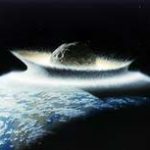Warum trifft der Klimawandel einige Tier- und Pflanzenarten besonders hart, während andere geradezu aufblühen? Ist es Schicksal, Zufall oder vielleicht doch ein Mix aus bestimmten Eigenschaften, der eine Spezies zum Überleben prädestiniert? Ausgehend auch von Massenaussterben der Vergangenheit haben Wissenschaftler diese Frage untersucht und sind tatsächlich fündig geworden. Es gibt Merkmale, die die Überlebenschancen einer Art erhöhen – oder sie zu Verlierern machen.
Toleranz ist Trumpf
Viele der heute vom Aussterben bedrohten Tierarten gehören zu Gruppen, die sehr enge Toleranzgrenzen haben: Korallenriffe gedeihen nur in Meerwasser bestimmter Temperatur, Koalas ernähren sich ausschließlich von Eukalyptusblättern, Eisbären verhungern ohne Meereis. Verändern sich die für diese Arten notwendigen Bedingungen, können sie sich nur schwer oder gar nicht anpassen, und sterben aus. Anders dagegen die Generalisten unter den Lebewesen: Sie tolerieren ein breiteres Spektrum an Umweltbedingungen und sind dadurch „einfach nicht totzukriegen“ – auch nicht durch den Klimawandel.
Ausbreiten lohnt sich
Eine gute Strategie ist auch ein möglichst ausgedehnter Lebensraum. Denn je weiter verbreitet eine Art ist, desto unwahrscheinlicher wird es, dass alle Populationen aussterben. Kommt sie dagegen nur in einem einzigen, noch dazu eng umgrenzten Gebiet vor, wird es kritisch: Eine „Pechsträhne“, wie beispielsweise eine lokale Dürre, eine Epidemie oder das plötzliche Auftauchen von übermächtiger Konkurrenz oder Fressfeinden in diesem Lebensraum, reicht dann schon aus. Sie vernichtet nicht nur die lokale Population, sondern damit gleichzeitig auch die letzten ihrer Art. Anfang der 1980er Jahre radierte beispielsweise ein Virus 95 Prozent aller Seeigel der Gattung Diadema in der Karibik aus. Doch da diese Gattung auch anderswo vorkam, konnte sie sich wieder von diesem Schlag erholen.
Sicherheit durch Masse
Auch in Bezug auf die Gruppengröße gilt: „Bigger is better“: Denn je kleiner eine Population ist, desto anfälliger ist sie. Die Ökologen Robert MacArthur und E.O. Wilson formulierten 1967 die Theorie der so genannten „minimum viable Population“ (MVP), nach der es eine untere Grenze der Überlebensfähigkeit in Bezug auf die Größe einer Gruppe gibt: „Populationen über diesem Wert sind praktisch immun gegen das Aussterben, solche unter der Grenze werden wahrscheinlich sehr schnell verschwinden.“ Kleine Gruppen sind anfälliger gegenüber äußeren Faktoren: Nahrungsmangel durch Dürre, ein Waldbrand oder andere lokale Störungen können zum Aussterben einer ganzen Population führen, wenn sie ohnehin nur aus wenigen Tieren bestand.

Vorschäden durch „Erstschlag“
Viele bedrohte Arten fallen nicht einem einzigen Faktor zum Opfer, sondern sterben quasi in zwei Etappen: In einer Art „Erstschlag“ führen eine ungewöhnliche Belastung wie der Klimawandel, die Verkleinerung des Lebensraumes oder die intensive Bejagung durch den Menschen dazu, dass Populationsgröße und Verbreitungsgebiet dramatisch schrumpfen. Die dadurch besonders anfällig gewordene Art fällt dann in der zweiten Etappe einem Ereignis zum Opfer, dass sie ungeschwächt leicht überlebt hätte.
Ein gutes Beispiel dafür ist das Heidehuhn (Tympanuchus cupido). Bis Mitte des 19. Jahrhunderts an der gesamten Ostküste der USA verbreitet, dezimierten Jagd und Lebensraumvernichtung bis 1870 die Art soweit, dass es nur noch auf der Insel Martha’s Vinyard vor der Küste von Massachussetts Überlebende gab. Den letzten Tieren machte dann 1932 ein Buschfeuer, gefolgt von einem harten Winter und einer Epidemie, endgültig den Garaus. Nach Ansicht von Ökologen hätte das Heidehuhn als Art allerdings all dies problemlos überlebt, wenn es nicht durch den „Erstschlag“ bis auf die kleine Inselpopulation zusammengeschrumpft wäre.
Bei vielen heute bedrohten Tier- und Pflanzenarten hat der Mensch gleich bei beiden „Etappen“ seine Finger im Spiel: Erst vernichtet er den Lebensraum oder nimmt die Nahrungsgrundlage, dann gibt ihnen der anthropogene Klimawandel den Rest…
Nadja Podbregar
Stand: 14.11.2008