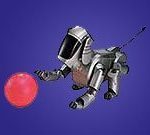g-o.de:
Also haben sie dem Roboter einen „Nervenverband“ programmiert?
Kirchner:
Wir würden es wohl eher „embodied cognition“ nennen, ein körpereigenes Wissen. Der größte Teil der Bewegungen wird von dieser dezentralen Software gesteuert, die das zentrale Roboter-Gehirn entlastet. Nur noch die übergeordneten Entscheidungsprozesse finden auf der oberen Ebene statt. Bei einem Experiment in unserem Labor etwa, steuerte ein Kollege den Roboter nur mit einem Mikrofon. Seine Sprachbefehle setzte das „Gehirn“ nur in elektronische Information um, und schickte es an die Software in den Körperteilen weiter, die den Bewegungsablauf initiierten. Damit arbeit das ganze System effizienter und ist viel robuster.
g-o.de:
Verarbeitet der Roboter so alle Informationen, die er von Außen erhält? Oder wie gewinnt er ein Bild seiner Umwelt?

Scorpion auf "Wanderschaft" © Harald Frater
Kirchner:
Ja und Nein. Beim „Scorpion“ haben wir bisher auf die elektronischen Informationssysteme wie Sensoren, Laser und Radar verzichtet. Die haben Tiere auch nicht. Wir interessieren uns dafür, welche Information aus dem Roboter selbst kommt. Der Körper erzählt uns ständig Anhaltspunkte über seine Umgebung. Geht er etwa durch eine Schlammpfütze, registriert er, dass seine Füße in die Fläche einsinken und es schwerer ist das Bein wieder aus dem Schlick zu ziehen. Er speichert diese Situation als „Erfahrung“ in einem Katalog ab. Die Information kommt in diesem Fall also nicht von Außen über die Kontrollebene, sondern direkt aus den Beinen.
g-o.de:
Hat die „Erinnerung“ denn auch für spätere Handlungen einen Wert für den Roboter?
Kirchner:
Hier setzt die eigentliche Kognition an. Das Bild der Kamera ist für den Roboter zunächst nur eine Ansammlung schwarzer und weißer Punkte, ohne jegliche Information. Entweder der Programmierer müsste „Scorpion“ für jedes Bild die Bedeutung beibringen – oder der Roboter lernt es selbst. Dafür muss er eine Verbindung zwischen dem Bild und der Information seiner Erfahrung herstellen. Beispielsweise assoziiert er jetzt mit der bestimmten Punkteansammlung einer Schlammpfütze auf dem Video, die Erfahrung wie er schon einmal auf einen nachgebenden Untergrund reagiert hat. In Zukunft wird er die Pfütze umgehen, oder seine Beine schon vorher an die Belastung anpassen können.
g-o.de:
In wiefern ist das für Rettungsroboter wichtig?
Kirchner:
Je selbstständiger der Roboter arbeiten kann, desto besser ist der Operator entlastet. Im Idealfall kann ein Rettungsleiter mehrere Robotersysteme gleichzeitig steuern und so seine Arbeitskraft optimieren.
g-o.de:
Ist „Scorpion“ denn schon in einer richtigen Katastrophe zum Einsatz gekommen?
Kirchner:
Wir arbeiten sehr eng mit dem THW Hannover zusammen, um „Scorpion“ möglichst viel Erfahrung zu ermöglichen. Der erste Praxis-Test war die internationale Katastrophenübung DACH in der Schweiz, wo unsere wissenschaftlichen Ideen sich im harten Rettungsalltag bewähren mussten. Danach haben wir die Verbesserungsvorschläge umgesetzt und stellen jetzt gerade einen Antrag beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf eine regelmäßige Zusammenarbeit mit dem THW.
g-o.de:
Wie sehen sie die Zukunft für „Scorpion“?
Kirchner:
Ich bin überzeugt, dass uns mit dem bio-inspirierten System noch viele Möglichkeiten offen stehen. Durch ein geschicktes Co-design der Natur können wir die Hard- uns Software noch viel effizienter gestalten, um beispielsweise so energiesparend wie biologische Systeme zu werden. Kürzlich haben wir etwa zur Dämpfung der Beine die System-gesteuerte Hydraulik durch eine Feder ersetzt. Nach anfänglichen Programmierproblemen haben wir jetzt eine energieeffiziente und problemlose Lösung gefunden.
g-o.de:
Herr Kirchner, vielen Dank für dieses Interview und weiterhin viel Erfolg.
Stand: 10.03.2006
10. März 2006