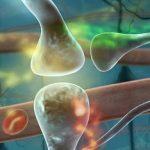Wenn wir nach dem Sex mit unserem Partner oder dem fürsorglichen Kuscheln mit unserem Kind den wütenden Hund unseres Nachbarn übersehen, ist möglicherweise das Oxytocin schuld. Denn das Kuschelhormon macht uns zwar empfänglicher für positive soziale Signale, hemmt aber gleichzeitig unsere Angst und damit auch unsere Vorsicht. Das hat Vorteile, kann aber auch negative Folgen haben.
Die typische Angstreaktion
Wie das Oxytocin unser Angstgefühl beeinflusst, haben Forscher schon vor einigen Jahren mit Experimenten im Hirnscanner aufgedeckt. Dabei zeigten sie Probanden Portraits menschlicher Gesichter mit neutralem Ausdruck und verabreichten ihnen bei einem Teil der Bilder einen leichten, aber schmerzhaften Elektroschock.
Wie erwartet lösten diese Bilder beim Wiedersehen prompt eine unwillkürliche Schreckreaktion aus – selbst wenn gar kein Elektroschock mehr folgte. Diese normale Angstreaktion ließ sich auch im Gehirn der Teilnehmer verfolgen: Beim Anblick der mit dem Schock assoziierten Gesichter stieg die Hirnaktivität in der Amygdala und dem sogenannten fusiformen Gesichtsareal an, einem Bereich, der speziell bedrohliche Gesichter verarbeitet. Beide Areale leuchteten deutlich sichtbar auf.
Schreckreaktion gehemmt
Doch das änderte sich, als die Forscher der Hälfte ihrer Probanden eine Dosis Oxytocin-Nasenspray verabreichten. Als diese nun die angstauslösenden Bilder anschauten, tat sich ihrer Amygdala kaum mehr etwas. Gleichzeitig wurden angsthemmende Areale aktiv und auch die funktionelle Verknüpfung zwischen dem Mandelkern und Regionen im Hirnstamm, die die körperlichen Angstreaktionen regulieren, schwächte sich ab.
Auch subjektiv zeigte sich die angsthemmende Wirkung des Kuschelhormons: „Als wir der Oxytocin-Gruppe erneut die beiden Gesichter zeigten, die zuvor mit einem Elektroschock assoziiert waren, empfanden sie diese plötzlich nicht mehr unangenehm“, berichtet Predrag Petrovic vom Karolinska Institut in Göteborg. „Diejenigen jedoch, die das Placebo erhalten hatten, reagierten noch immer mit Abneigung.“
Hilfe gegen Phobien?
Dieser angstlösende Effekt des Oxytocins hat Vorteile. Denn er macht es leichter, ohne Furcht auf jemanden zuzugehen und fördert dadurch soziale Kontakte und Bindungen. Und für Menschen, die an krankhaften Ängsten oder posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, könnte sich das Kuschelhormon sogar als wertvolles Therapiemittel erweisen. Denn bei diesen Menschen haben sich traumatische Erfahrungen tief ins Gedächtnis eingegraben oder sie wurden – beispielsweise durch frühkindliche Erlebnisse – auf bestimmte Ängste hin konditioniert.
Bisher versucht man, diese übersteigerten Angstzustände durch Psychotherapie und Verhaltenstraining zu kurieren. Dazu gehört auch eine Art Desensibilisierung, bei der die Betroffenen sich den angstauslösenden Situationen aussetzen. Das Gehirn lernt dabei nach und nach, dass in Wirklichkeit keine Gefahr droht. „Bei diesem Prozess wird die ursprünglichen Erinnerung aber nicht ausgelöscht, sondern nur durch positive Erfahrungen überlagert“, erklärt René Hurlemann von der Universität Bonn. „Das dauert sehr lange und es kann zu Rückfällen kommen, weil die alte Angst noch im Gedächtnis verankert ist.“
Genau hier aber könnte das Oxytocin helfen. Denn unter Einfluss des Kuschelhormons läuft dieser Prozess der Extinktion erheblich schneller ab, wie Experimente belegen. Bei Probanden sank die Aktivität im Angstzentrum unter Oxytocin deutlich stärker ab als mit einem Placebo. Für Betroffene hieße dies, dass ihre Therapie schneller anschlägt und sie weniger Rückfälle befürchten müssen. Ob das aber tatsächlich so ist, müssen klinische Studien erst noch zeigen.
Durch die rosa Brille
So angenehm es auch ist, weniger Angst zu empfinden – es hat auch Nachteile. Denn das Oxytocin verpasst uns auch „rosa Brille“, durch die wir wichtige Gefahrensignale leichter übersehen, wie eine Studie mit Rhesusaffen im Jahr 2013 nahelegte. Bei dieser zeigte sich, dass Affen unter Einfluss des Kuschelhormons weniger aufmerksam auf potenziell bedrohliche dominante Artgenossen achteten. Ihr normalerweise stark ausgeprägtes Misstrauen gegenüber diesen Rivalen sank.
Noch ist nicht klar, ob das Kuschelhormon auch bei uns das Misstrauen und die soziale Wachsamkeit schwinden lässt. Die Forscher halten es jedoch für durchaus wahrscheinlich, weil wir mit den Affen eng verwandt sind und auch unser Sozialverhalten viele Parallelen aufweist. Zu viel Kuscheln oder eine Dosis Oxytocin-Nasenspray wären demnach sicher eher kontraproduktiv, wenn wir direkt anschließend harte Verhandlungen führen müssen oder in potenziell gefährliche Situationen geraten.
Nadja Podbregar
Stand: 17.07.2015