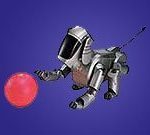Obwohl Wissenschaftler immer wieder neue Phänomene der Natur entdecken und erforschen, bleibt deren Potenzial als Vorbild für technische Entwicklungen zunächst meist unerkannt. So erging es auch dem Phänomen des Lotus-Effekts.
In den 70er Jahren untersuchen der Botaniker Wilhelm Barthlott und seine Kollegin Nesta Ehler eine Reihe von Pflanzenblättern mithilfe des damals neuen Rasterelektronenmikroskops. Sie wollen wissen, ob sich die Verwandtschaft verschiedener Pflanzengruppen in den Oberflächenstrukturen ihrer Blätter widerspiegelt.
Bei der Präparation der Blätter fällt ihnen auf, dass erstaunlicherweise gerade Blätter mit glatten Oberflächen meist schmutziger sind als solche, die unter dem Mikroskop rauhe Strukturen zeigten. Besonders deutlich wird dieser Effekt bei der Lotuspflanze Nelumbo nucifera: Ihre mikroskopisch fein genoppten und mit Wachskristallen besetzten Blätter lassen das Wasser und Schmutz vollkommen abperlen.
Da diese Beobachtung den beiden Forschern zunächst zu nebensächlich erscheint und zudem den gängigen Theorien der Oberflächentechniker widerspricht, beschreiben sie das Phänomen nur in einer kleinen Randnotiz und messen ihm keine weitere Bedeutung bei. Es sollte zwölf Jahre dauern, bis der Lotus-Effekt wieder aus der Versenkung auftaucht. Erst 1989 greifen Barthlott und sein Doktorand Christoph Neinhuis das „Phänomen der sauberen Blätter“ wieder auf und gehen der Sache in Experimenten und mikroskopischen Studien auf den Grund.