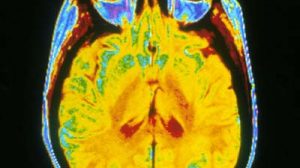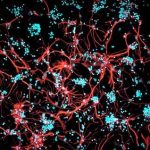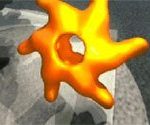{1r}
Das Gefühl, zu dick zu sein, die Angst zuzunehmen, ständiges Messen und Wiegen des eigenen Körpers und die Vermeidung, sich anderen zu zeigen, quälen essgestörte Patientinnen und Patienten, die objektiv normal- oder untergewichtig sind. Studien haben gezeigt, dass Betroffene ihren eigenen Körper viel umfangreicher wahrnehmen, als er tatsächlich ist, und sich unattraktiver einschätzen als Andere.
Die große Bedeutung des Körperbilds wurde lange vernachlässigt
Mit Bildern von sich selbst konfrontiert, suchen sie geradezu die vermeintlichen Schwachstellen, während sie positive Eigenschaften ausblenden. Bei der Betrachtung Anderer funktioniert das umgekehrt. Die Betrachtung des eigenen Körpers ist mit Gefühlen wie Traurigkeit und Ekel verbunden.
„Die große Bedeutung des gestörten Körperbilds wurde in der Therapie von Essstörungen lange vernachlässigt“, sagt Dr. Silja Vocks von der Ruhr-Universität Bochum (RUB). Sie ist dem Problem seit Jahren auf der Spur. Gemeinsam mit einer Kollegin hat sie eine Gruppentherapie entwickelt, die hilft, das Verhältnis zum eigenen Körper wieder zu normalisieren, ihn immer weniger als Feind zu begreifen.

Bestandsaufnahme steht am Beginn der Therapie
Am Beginn der so genannten Körperbildtherapie, die das Zentrum für Psychotherapie an der Fakultät für Psychologie der Ruhr-Universität seit 2003 anbietet, steht eine Bestandsaufnahme: ein Rückblick darauf, was vielleicht in der Kindheit und Jugend den Ausschlag in die falsche Richtung gegeben hat. In den folgenden Sitzungen – zehn Einheiten finden wöchentlich in Gruppen bis zu sechs Teilnehmerinnen statt – geht es darum, die negativen Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen zu erkennen und Schritt für Schritt zu verändern.
Die Konfrontation mit dem eigenen Körper im Spiegel vor der Gruppe und auf Video, der Abschied von Gedanken wie „Der Wert meiner Person hängt von meinem Gewicht ab“ und das Erlernen von positiven körperbetonten Aktivitäten zeigen Wirkung: Studien zufolge verbessert sich das Verhältnis zu sich selbst, werden die Einschätzungen des eigenen Körpers realistischer. Die Verbesserungen bleiben auch langfristig bestehen.
Meike Drießen /RUBIN/Ruhr-Universität Bochum
Stand: 04.09.2009