Was „tut“ das Gehirn, wenn unser Geist in der Nachtwelt wandelt? Wie funktioniert das Träumen? Diese Frage ist bis heute nicht beantwortet und heiß umstritten. Zwar sind sich alle Schlafforscher einig darüber, dass das Gehirn bei Träumen aktiv ist und keineswegs „schläft“, aber wie diese Aktivität mit den Inhalten und der Form unserer Träume zusammenhängt, weiß im Grunde keiner so genau.
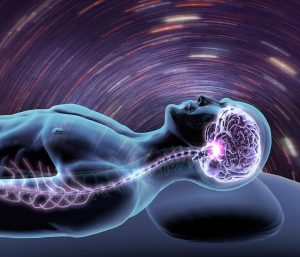
Sinnlose Signale?
Unter den ersten, die versuchten, dem physiologischen Hintergrund der Träume auf den Grund zu gehen, waren die amerikanischen Schlafforscher und Neurophysiologen J. Allan Hobson und Robert McCarley. Bei Schlafversuchen an Katzen stellten sie fest, dass eine kleine Region im Hirnstamm, das REM-Zentrum, während des Traumschlafs regelmäßige starke Bündel von Nervenimpulsen aussandte, die sich anschließend über die Großhirnrinde verteilten und dort ihrerseits Nervenzellen aktivierten.
Aus dieser Beobachtung entwickelten die Wissenschaftler ihr „Aktivierungs-Synthesis-Modell“ für das Träumen: Demnach entstehen Träume, weil das Großhirn die zufälligen Nervensignale aus dem REM-Zentrum genauso auswertet, wie die tagsüber von außen eintreffenden Reize. Es verknüpft die Hirnstammsignale mit bereits gespeicherten Gefühlen, Sinnesempfindungen oder Fakten und komponiert daraus den Trauminhalt – indem es die zum Reiz passende Geschichte „erfindet“. Weil dabei besonders die Hirnzentren aktiviert werden, die Emotionen und unser Langzeitgedächtnis bergen, sind auch unsere Traumgeschichten entsprechend reich an Gefühlen und Erinnerungen.
Einen Sinn haben diese Träume nach Ansicht vieler Traum- und Schlafforscher aber nicht. Sie sehen sie als bloßes Nebenprodukt der physiologischen Vorgänge, ähnlich dem statischen Rauschen eines Radios oder dem Brummen eines Motors. Eine Beschäftigung mit unseren Träumen oder gar Deutungsversuche sind daher ihrer Ansicht nach komplett sinnlos.












