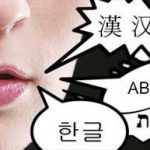Lars beherrscht seit seiner Kindheit Französisch und Polnisch. Maria besucht in Ägypten eine deutsche Schule – mit ihren Eltern spricht sie Deutsch, im Alltag umgangssprachliches Arabisch. Sina hat zwei Jahre in Schottland gelebt, ihr Freund war drei Monate im ERASMUS in Italien – sie alle beherrschen mehr als eine Sprache fließend. Aber sind sie auch alle bilingual?

Diese Frage lässt sich schwer beantworten, denn die Definition der Mehrsprachigkeit ist umstritten. Die meisten Linguisten glauben jedoch, dass alle bilingual sind, die mehr als eine Sprache beherrschen – egal in welchem Alter, wie lange oder in welchem Kontext diese erlernt wurde. „Menschen, die mehrsprachig sind, können zwei oder mehr Sprachen in mündlicher, manueller oder schriftlicher Form […] verstehen und verwenden“, definiert auch das Internationale Expertengremium für mehrsprachige kindliche Sprachentwicklung.
Multilinguale Welt, multilinguales Deutschland
Bilingualität ist demnach weit verbreitet: 60 bis 75 Prozent der Menschen weltweit sprechen zwei Sprachen, wie eine Befragung der Online-Plattform Statista zeigt. Auch ein Großteil der Deutschen beherrscht mehrere Sprachen: Etwa 40 Prozent geben an, zwei Sprachen zu beherrschen. Ein weiteres Viertel spricht fließend drei oder sogar noch mehr Sprachen.
Zweisprachler haben diese auf unterschiedlichen Wegen erlernt: Einige Kinder leben beispielsweise in Grenzgebieten. Andere unterhalten sich zu Hause mit Eltern und Geschwistern auf einer Sprache, etwa Arabisch, in der Schule oder im Kindergarten hingegen sprechen sie eine andere Sprache, etwa Deutsch. Am häufigsten sprechen diese sogenannten „lebensweltlichen Zweisprachler“ in Deutschland Russisch, Türkisch und Polnisch.