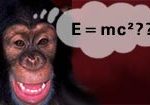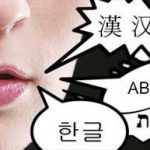Menschen sind in der Lage ihre Stimmlage, das Tempo oder ihren Sprechrhythmus zu verändern, zu reden oder zu singen. Zu verdanken haben wir dies unserem Kehlkopf und den Stimmbändern. Doch wir sind nicht die einzigen Lebewesen, die besondere Klänge erzeugen können. Auch im Tierreich entsteht eine Vielzahl Lauten – auch abseits von Kehlkopf und Stimmbändern.
In Höhen und Tiefen begabt

Große Tiere besitzen meist längere Stimmbänder und erzeugen damit auch tiefere Rufe. David Reby von der University of Sussex und seine Kollegen entdeckten aber einen Spezialfall: Der Schrei der nordamerikanischen Wapitis (Cervus canadensis) passt nicht zu ihrer imposanten Statur. Denn sie stoßen im Gegensatz zu verwandten Tierarten nicht nur tiefe, sondern auch hohe, durchdringende Schreie bei der Partnerwahl aus.
Die Bandbreite der Frequenzen dieser schrillen Rufe reicht von hohen Tönen mit 2.000 bis 4.000 Hertz bis zu sehr viel tieferer Tönen von rund 150 Hertz – was etwa der Tonlage röhrender Hirsche entspricht. Dank ihres Gaumensegels – das bis in den Rachen hineinragt – gelingt es den Wapiti, neben dem tiefen Röhren gleichzeitig durch hohe Schreie Weibchen von fern anzulocken, wie die Forscher erklären.
Schriller geht es nicht
Noch schriller sind aber die Töne, die Heuschrecken von sich geben können: Im südamerikanischen Regenwald entdeckten die Forscher um Fernando Montealegre-Z von der britischen University of Lincoln eine neue Gattung der Laubheuschrecken, die mit ihren Flügeln die höchsten bekannten Tonfrequenzen ihrer Tierordnung erzeugen.