Im Dezember 1966 war die Weihnachtsfeier an der Western Reserve University in Cleveland Ende gerade vorbei. Aber ein paar Kerzen, die vorher den festlichen Kuchen zierten, waren noch übrig. Diese brachten Joachim Lukas, einen deutschen Post-Doktoranden im Labor des Chemikers und späteren Nobelpreisträgers George Olah auf eine Idee.

Eine Kerze verschwindet
Lukas tauchte eine der Kerzen in ein Gefäß mit einem Gemisch aus Fluorsulfonsäure und Antimonpentafluorid, die im Chemielabor stand. Plötzlich fing die Kerze an, sich aufzulösen, und verschwand schließlich komplett. Aber was machte diese Beobachtung so besonders? „Der Name Paraffin leitet sich ab vom lateinischen parum affinis. Das bedeutet: fehlende Reaktionsfreudigkeit“, erklärt Olah im Deutschlandfunk. Gängige Säuren wie Salzsäure oder Schwefelsäure können das aus gesättigten Kohlenwasserstoffen bestehende Paraffin daher nicht auflösen.
„Doch wenn man Wachse mit Säuren behandelt, die zigfach stärker sind als zum Beispiel konzentrierte Schwefelsäure, kriegt man sie doch chemisch aktiviert.“ Genau dies war offenbar beim Gemisch aus Fluorsulfonsäure und Antimonpentafluorid der Fall. „Joachim Lukas war so begeistert, dass er sagte: Hier haben wir es wirklich mit einer magischen Säure zu tun“, erinnert sich Olah. „Später hat sich dieser Name dann auch in der Fachliteratur eingebürgert.“ Zuvor hatte das Gemisch aus Fluorsulfonsäure und Antimonpentafluorid noch keinen Namen.
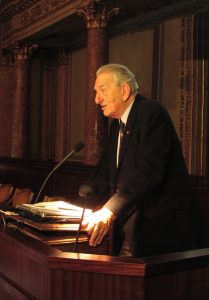
Hexafluorantimonsäure – die Säure-Nimmersatt
Die „Magische Säure“, mit der Lukas und seine Kollegen experimentierten, ist eine sogenannte Supersäure. Dabei handelt es sich um Säuren, die stärker als eine 100-prozentige Schwefelsäure sind. Doch das Gemisch aus Fluorsulfonsäure und Antimonpentafluorid ist sogar 100 Milliarden Mal stärker als die hochkonzentrierte Schwefelsäure.














