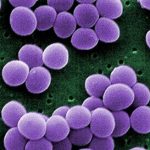Auf den Menschen übertragen werden die Borrelien meist nicht sofort nach dem Biss der Zecke, sondern oft erst nach 24 bis 48 Stunden – dann, wenn das Tier die mit dem Blut aufgenommene überschüssige Flüssigkeit wieder in die Wunde zurückpumpt und damit auch die Borrelien aus ihrem Verdauungstrakt dorthin gelangen. In Deutschland ziehen nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts rund drei bis sechs Prozent der Zeckenbisse eine Infektion nach sich, bei 0,3 bis 1,4 Prozent der Gebissenen bricht die Krankheit aus.

Mundwerkzeuge einer adulten Zecke © EUCALB
Das größte Risiko für eine Infektion besteht zwischen Frühjahr und Herbst, prinzipiell kann sich aber bei einem milden Winter und eher feuchtkühlen Sommer die Zeckenaktivität über das gesamte Jahr erstrecken. Je nach Temperatur kann die Zeckensaison bereits im späten März oder aber auch erst im April beginnen und erstreckt sich dann bis zum Beginn der Winterruhe der Tiere im Spätherbst.
Symptome:
Stadium 1:
Ein typisches erstes Anzeichen einer Borrelieninfektion ist eine Tage bis Wochen nach dem Zeckenbiss auftretende charakteristische Hautrötung, die so genannte Wanderröte oder Erythema migrans. Die in rund 60 Prozent der Fälle beobachtete Rötung breitet sich langsam um die Bissstelle aus und kann im Extremfall bis zu 75 Zentimeter Durchmesser erreichen. Gleichzeitig können auch grippeähnliche Symptome, wie Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen oder Lymphknotenschwellungen auftreten. Diese Symptome verschwinden einige Zeit später auch ohne Behandlung wieder.
Stadium 2:
Im Laufe von einigen Wochen bis mehreren Monaten nach der Infektion breitet sich der Erreger über Blut und Lymphe auch in andere Körperregionen aus und befällt hier Nerven, Muskeln oder Gelenke. Neben einem allgemeinen Krankheits- oder Schwächegefühl kann es dadurch zu starken, anhaltenden Nerven- oder Muskelschmerzen, aber auch zu Herzmuskelentzündungen, Hirnhaut und Gehirnentzündungen oder sogar Lähmungen an Extremitäten oder im Gesicht kommen.
Stadium 3:
Nach einigen Monaten bis Jahren kann sich eine chronische Borreliose manifestieren. Sie wird durch Erreger ausgelöst, die sich an für die Immunabwehr nicht zugänglichen Stellen des Körpers eingenistet haben. Häufigste Spätfolgen sind die Lyme-Arthritis und eine stellenweise Ausdünnung und Verfärbung der Haut, die Acrodermatits atrophicans. Auch chronische Herzmuskelschäden und wenn auch selten, eine chronische Hirnhautentzündung sind möglich.
Behandlung:
In der Frühphase der Infektion können Antibiotika die Krankheit wirksam bekämpfen. Die Therapie erstreckt sich je nach Schwere der Symptome über zwei bis vier Wochen. Hat die Borreliose das chronische Stadium erreicht, ist die Behandlung erheblich schwerer, da die Erreger sich dann in nur schwer zugänglichen Körpergeweben befinden. Das RKI rät jedoch davon ab, nach jedem Zeckenbiss gleich vorbeugend Antibiotika zu schlucken.
Vorbeugung:
Eine Schutzimpfung gibt es für die europäische Borreliosevarianten bisher nicht. In den USA wurde vor kurzem ein Impfstoff entwickelt, der gegen das äußere Membranprotein des Bakteriums immunisiert. Da jedoch in Europa mehrere unterschiedliche Erregerstämme die Krankheit hervorrufen können, ist dieser Impfstoff hier nicht wirksam.
Die wirkungsvollste Vorbeugung gegen eine Infektion besteht daher darin, einen Zeckenbiss von vornherein zu vermeiden. Aber auch das gründliche Absuchen des Körpers nach einem Aufenthalt im Freiland kann das Infektionsrisiko ebenfalls stark mindern.
Stand: 06.05.2002
6. Mai 2002