Wie bei fast allen bahnbrechenden Entdeckungen in der Wissenschaft geht es bei der Genschere nicht nur um Fortschritt – sondern auch um Ruhm und viel Geld. Doch wer darf an CRISPR/ Cas9 verdienen? Bei dem von Charpentier in Bakterien entdeckten System handelt es sich per Definition zunächst einmal um einen „natürlichen Prozess“. Als solcher ist dieser nach geltendem Gesetz weder in der Europäischen Union, noch in den USA patentierbar.
Allerdings: Die Leistung, aus dem ursprünglichen System ein Genome-Editing-Werkzeug gemacht zu haben, lässt sich sehr wohl patentieren: als mikrobiologisches Verfahren. Deshalb reichten Charpentier und Doudna nach der Veröffentlichung ihres wegweisenden Aufsatzes im Mai 2012 gemeinsam mit der Universität in Berkeley einen Patentantrag bei der entsprechenden US-Behörde ein.
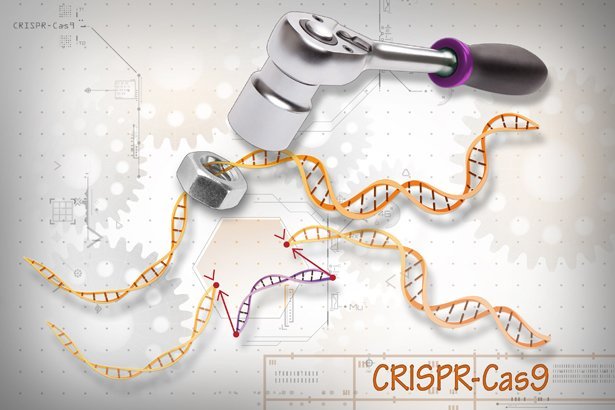
Eins zu null für Zhang
Doch sie hatten einen Nebenbuhler: Auch Bioingenieur Feng Zhang vom Broad Institute des Masschusetts Institute of Technology in Cambridge gab wenige Monate nach den Mikrobiologinnen einen Antrag beim Patentamt ab. Er hatte zuvor zum ersten Mal gezeigt, wie sich das CRISPR-Verfahren außerhalb von Bakterien nutzen lässt und die Methode unter anderem bei Mäusen und menschlichen Zellen angewandt.
Überraschenderweise bekam der Wissenschaftler das Patent im Frühjahr 2014 tatsächlich zugesprochen – und nicht das mit zahlreichen Wissenschaftspreisen geehrte Forscherinnen-Team. Die Begründung: Zhang habe die Methode für alle Zellen tauglich gemacht und sei damit der wahre Erfinder des Universalwerkzeugs. Doch die Universität in Berkeley sieht das anders. Sie argumentiert, der Schritt von Pro- zu Eukaryoten bedürfe keiner erfinderischen Tätigkeit – und hat Klage gegen die Entscheidung eingereicht. Seit Januar 2016 läuft nun ein Verfahren zur Klärung der Urheberschaft.













