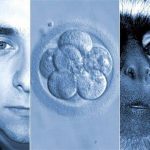Welche Eingriffe in das menschliche Erbgut sind ethisch vertretbar und vielleicht sogar geboten? Und welche nicht? Über diese Frage wird schon seit fast 100 Jahren debattiert. Lange bevor die Struktur der DNA bekannt war oder erste Werkzeuge für eine Genmanipulation existierten, gab es schon geteilte Ansichten über Chancen und Risiken solcher Technologien. Wo die einen die Aussicht auf eine Welt ohne Krankheiten und mit perfekten Menschen priesen, sahen andere die Gefahr einer neuen Eugenik, einer genetischen Auslese ähnlich wie in Aldous Huxleys Roman „Schöne Neue Welt“.

Kommende Generationen betroffen
Über eine ethische Grenze schien allerdings bis vor kurzem noch Einigkeit zu bestehen: die Barriere zwischen der somatischen Gentherapie und einem Eingriff in die Keimbahn. Eines der Argumente: Ein Individuum, das an einem Gendefekt leidet, sollte die Chance haben, mittels Gentherapie geheilt zu werden. Weil die Entscheidung darüber und die damit verbundenen Risiken nur diese eine Person betreffen, ist es ihre persönliche Freiheit, sich einer somatischen Gentherapie zu unterziehen.
Anders sieht dies bei einer Keimbahntherapie aus: Sie betrifft nicht nur ein Individuum, sondern auch alle seine Nachkommen – und diese haben nicht die Chance, ihre Zustimmung zu geben oder Einspruch zu erheben. „Betroffen ist letztlich die menschliche Spezies und damit eine Abstraktion die man weder treffen noch direkt fragen kann“, erklärt der Bioethiker John Evans von der University of California in San Diego.
Hilfe für aussichtslose Fälle
Allerdings gibt es auch Grenzfälle: Wenn ein Gendefekt beispielsweise die Hirnentwicklung eines Menschen betrifft, lassen sich die Schäden und Defizite nach der Geburt oft nicht mehr rückgängig machen. Eine somatische Gentherapie käme dann zu spät und hätte zudem das Problem, dass unser Gehirn durch die Blut-Hirnschranke gegen viele Eingriffe – und auch die Genschere – geschützt ist.