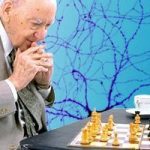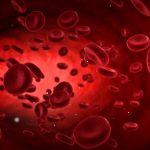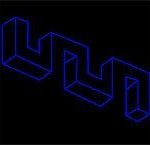Was treibt einen Physiker zu den Biowissenschaften, genauer gesagt, in die von Nobelpreisträger Bert Sakmann geleitete Abteilung für Zellphysiologie am Heidelberger Max-Planck-Institut für medizinische Forschung? Fritjof Helmchen quittiert die Frage zunächst mit einem Lachen. „Ein gewisser Hang zur belebten Welt muss wohl schon da gewesen sein, denn ich habe auch ein paar Semester Medizin studiert und sogar das Physikum geschafft“, sagt er, und ein Quäntchen Stolz ist nicht zu überhören. „Nein, im Ernst, Physiker haben so etwas wie ein natürliches Interesse für komplexe Systeme – und das Gehirn ist eines der komplexesten Systeme überhaupt.“
Dem etwa drei Pfund schweren Organ unter der Schädeldecke entspringt letztlich unser gesamtes Fühlen, Denken und Handeln. Um all das hervorzubringen, werkelt im Oberstübchen ein schier unendlich verzweigtes Netzwerk aus 100 Milliarden Nervenzellen. Diese Neuronen sind mit ihrer elektrischen Erregbarkeit für Verarbeitung und Weiterleitung von Signalen zuständig. Ein optischer Reiz etwa gelangt von der Netzhaut über den Sehnerv zu den visuellen Zentren in der Hirnrinde, dem Kortex, wo dann der Seheindruck entsteht.
Stiefkinder unter den Hirnzellen
{1r}
Neben den Neuronen gibt es im Gehirn aber noch eine andere ähnlich zahlreiche Zellpopulation – die Gliazellen. Ihr Name, abgeleitet vom griechischen Wort glia – Leim -, deutet schon an, welche Nebenrolle ihnen die Neurowissenschaft lange zuschrieb: Danach sollten sie reine Stützzellen sein, die wie eine Art Nervenkitt die Neuronen zusammenhalten und mit Nährstoffen versorgen.