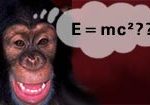Die Medizin ist eines der größten Einsatzgebiete für tierische Helfer. Der mit Abstand dienstälteste Gefährte in diesem Bereich ist wahrscheinlich der Blindenhund. Als sogenannte Assistenzhunde helfen Vierbeiner aber auch Menschen mit anderen Einschränkungen. Dafür erhalten sie eine umfangreiche Ausbildung, die speziell an die Bedürfnisse ihres späteren Halters angepasst wird.
Besonders erfolgreich werden Hunde zum Beispiel als Begleiter für Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) eingesetzt. Die Vierbeiner geben den Patienten dabei nicht nur durch ihre Nähe emotionalen Halt. Sie lernen unter anderem Distanz zu Fremden zu schaffen, Licht in dunklen Räumen anzuschalten oder ihre Besitzer bei einer Panikattacke im Supermarkt zum Ausgang oder an einen ruhigen Ort zu führen.

Streicheln hilft
Doch auch ohne spezielle Ausbildung können Tiere kranken Menschen helfen: Studien legen nahe, dass sich schon die reine Anwesenheit eines Tieres positiv auswirkt. Wer ihr Fell streichelt, bei dem sinken Blutdruck und Herzfrequenz, zudem wird das als Kuschel- und Glückshormon bekannte Oxytocin ausgeschüttet. Aus diesem Grund kommen Hunde, Katzen und Co zum Beispiel in Altenheimen und Krankenhäusern zum Einsatz. Oftmals übernehmen sie zudem in der Psycho- und Verhaltenstherapie die Rolle des Co-Therapeuten – als emotionale Türöffner, Anti-Stress-Mittel oder Lehrer für soziale Kompetenzen.
Neben dem Assistieren und Therapieren beherrschen einige Tiere sogar das Diagnostizieren: Dank ihrer feinen Nase können zum Beispiel Hunde darauf trainiert werden, Infektionen wie Malaria oder Krebserkrankungen zu erschnüffeln. Forscher gehen davon aus, dass es spezifische chemische Substanzen gibt, die von Krebszellen abgegeben werden und für die Vierbeiner wahrnehmbar sind.