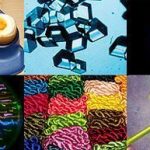Warum sollte man Pflanzenzellen dazu bringen, sich wie Fleisch zu verhalten, wenn man auch tierische Zellen dafür nehmen kann? Genau das ist die Idee hinter In-vitro-Fleisch – Fleisch, das im Reagenzglas wächst. Das Prinzip: Einem lebenden Tier werden im Rahmen einer Biopsie Muskelstammzellen entnommen und diese dann im Labor vermehrt.
Dabei entwickeln sich die Zellen in einer Nährlösung zu ausdifferenzierten Muskelzellen, die schließlich auf einer Art Gerüst zu Muskelfasern zusammenwachsen. Diese Methode entspricht im Grunde dem Züchten von Gewebe zu medizinischen Zwecken, wie es sich etwa bei Hauttransplantationen bewährt hat.
Der Machbarkeitsbeweis
Dass sich das künstlich gewonnene Gewebe tatsächlich zu so etwas wie einem Fleischstück verarbeiten lässt, bewiesen Forscher erstmals im Jahr 2013. Damals präsentierte ein Team um Mark Post von der Universität Maastricht den ersten In-vitro-Burger: eine Rinderbulette, zusammengesetzt aus 20.000 winzigen Muskelfaserstreifen.
Geschmacklich überzeugte diese Premiere allerdings nur mäßig. So meldeten es die österreichische Lebensmittelforscherin Hanni Rützler und der US-Ernährungsjournalist Josh Schonwald, die die Fleischhäppchen bei einem Testessen in London als Erste serviert bekamen. Beide hätten sich nach eigener Aussage über Ketchup gefreut. Ebenfalls wenig überzeugend waren damals die Herstellungskosten: stolze 250.000 Euro pro Burger.